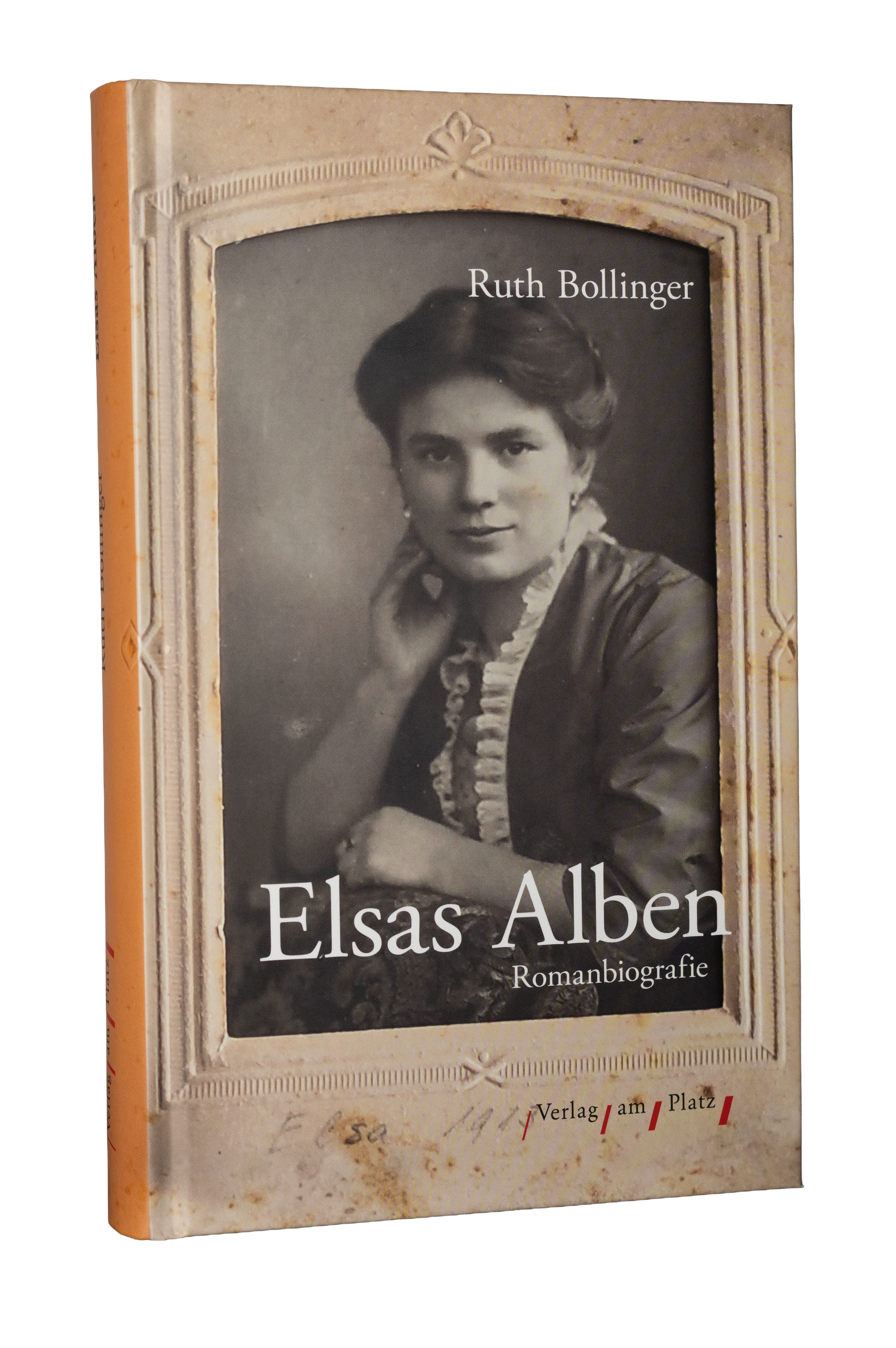Das Oktoberfest auf der Schaffhauser Breite war fast ausverkauft. Warum bloss?
Um Viertel nach neun steht im vorderen Teil der Festhalle der Parlamentarier Michael Mundt von seiner Festbank auf und startet eine Polonaise. Die im Takt wippende Menschenschlange zieht um drei Ecken, macht dann eine 180-Grad-Wende und tanzt wieder sich selbst entgegen. Die Mostlandstürmer stimmen auf der Bühne «Rolling on the River» an.
Ich stehe abseits des Epizentrums und lungere beim Biertresen herum. Etwas hölzern habe ich gerade eine Frau auf ihr Dirndl angesprochen. Ich will herausfinden, warum Menschen an dieses Oktoberfest gehen und warum sie dafür Trachten tragen. Auch, weil ich beides selber nie getan habe und bis jetzt auch recht dezidiert nicht vorhatte. Vorab hatte ich mir ein Theoriegerüst zusammengebaut: zu Traditionen, die in Schaffhausen (oder Zürich, oder Winterthur, oder Luzern – Ableger des Oktoberfests gibt es überall) zwar nicht verwurzelt sind, deren Codes jedoch so leicht verständlich und über kulturelle Osmose derart populär geworden sind, dass sich ein Fremdheitsgefühl gar nicht erst einstellen kann. Man weiss von Beginn weg, wie man sich an diesem neuen Ort zu verhalten hat, und muss für einmal nichts, gar nichts hinterfragen – Eskapismus unter dem Filzhut des Brauchtums.
Das sieht offenbar auch die Frau so, die ich beim Tresen angesprochen habe. Statt meine Fragen zu klären, zieht sie mich in die Polonaise hinein, als diese uns passiert. Danach ist sie verschwunden.
Das Bocktoberfest ist das erste grössere Oktoberfest in Schaffhausen seit Jahren. Manche erinnern sich an jene in der Kammgarn West, noch vor der Pandemie. Die Bilder und Rituale haben das Virus überdauert: lachende Menschen in hübschen Trachten, blauweisses Karomuster, Brezn, Brüste und Bier. Zu Schlager- und Partyhits tanzt man am liebsten auf den Bänken, und zum Ruf «Zicke zacke, zicke zacke, hoi hoi hoi» stemmt man die Masskrüge in die Höhe.
Rund 6,5 Millionen Besucher:innen strömten in diesem Jahr zum Münchner Oktoberfest – darunter auch Promis aus Kultur und Politik. Das «Bocktoberfest» auf der Breite zog am letzten Wochenende rund 1600 Menschen an, und auch hier liess sich die Polit-High-Society den Anlass nicht entgehen.
Bloss: Warum? Und hat das wirklich etwas mit Tradition zu tun?
Der berstende Hammer
Vier Stunden vor Michael Mundts Polonaise öffnen vor der Messehalle die Türen. Einige Gruppen, mehrheitlich in Lederhosen und mittelalt, stehen bereits Schlange. An ihnen vorbei ziehen ein paar irritierte junge Männer in Richtung Geflüchtetenunterkunft in der Zivilschutzanlage. Ohne Sitzplatzreservation ist hier kein Hineinkommen.
Auch im Innern gelten klare Regeln. Kaum haben sich die ersten Gruppen gesetzt, nähern sich Kellner:innen mit angespanntem Bizeps und bis zu sechs Masskrügen Bier pro Hand den Tischen, im Hintergrund buckeln bald die ersten Angestellten ganze Holzbretter voller Haxn, Käsespätzle und Kartoffelsalat. Dann stellt sich Jonas Mielsch, Moderator bei Radio Munot und des heutigen Abends, auf die Bühne. «Auf den Bänken darf man stehen und tanzen», sagt er, «aber nicht auf den Tischen. Das kostet 500 Franken.»

Begonnen hat das Fest erst mit dem Fassanstich. Während im Original sechs Münchner Brauereien exklusiv Oktoberfestbier verkaufen dürfen, setzt man in Schaffhausen auf Altbewährtes: Der Dank des Moderators geht an den Hauptsponsor Falken, «damit es das Wichtigste am Oktoberfest gibt.» Und während in Bayern dem Oberbürgermeister die Bürde zukommt, die Massen mit Hopfen und Malz zu versorgen, bindet sich auf der Breite der Stadtpräsident Peter Neukomm die Lederschürze um.
Zwei Schläge brauche er, um den Keil ins Fass zu rammen, vermutet er. Beim achten Schlag zerfällt stattdessen der Holzhammer in zwei Teile, und die Organisatorinnen rennen mit einem Ersatz heran. Dann sitzt der Keil fest im Fass, und Schaum blubbert in den ersten Krug. Ein grosser Oktoberfest-Fan sei er zwar nicht, sagt Neukomm, aber das tut hier nichts zur Sache. Für das Schauspiel reicht es.
Rundherum nimmt das Fest allmählich Form an. Von einem Tisch Eingefleischter aus übertragen sich die Konventionen auf die gesamte Halle: Mehr und mehr Menschen stellen sich auf die Bänke, die sich unter dem Gewicht biegen. Manche strecken die Arme aus, machen «Fingerguns» und singen lauthals zu «Bella Napoli», «Hey Jude» und «Skandal im Sperrbezirk». Bei «Country Roads» beginnt auch der Thaynger alt Gemeindepräsident Marcel Fringer, die Hüfte zu schwingen.
Dazwischen versuchen einige noch zu essen – wie vieles an diesem Abend ist der Übergang zwischen Dinner und Party fliessend. Eine Frau stellt ihren Teller mit angebissenem Hendl vor mich und setzt sich mir gegenüber. Ihr wird vom Gewackel auf der Bank nebenan übel, erklärt sie. Sie heisst Claudia, hat zwar nicht Oktoberfest-, aber Guggenmusikerfahrung, und trägt nebst einem silbernen Dirndl Schmetterlingstattoos am Handgelenk. Komplimente für beides nimmt sie mit einem Lächeln an. Warum finden Menschen das Oktoberfest bloss so cool, frage ich sie. «Na, wegen des Biers», sagt sie ohne zu zögern und legt einen Coupon dafür auf den Tisch. Sie selber trinkt Cola mit Mineralwasser verdünnt – aber im Masskrug, damit es nach etwas aussieht. Einer aus ihrer Gruppe tut es ihr mit Rivella gleich. Er sagt: «Ich mag, dass man hier mit allen anstossen kann. Das gibt ein Gefühl von Zusammengehörigkeit.» Tatsächlich mischen sich die Gruppen untereinander wenig, was der Reservationspflicht geschuldet sein mag. Aber Verbundenheit entsteht auch, wenn ein zweiter sich auf dieselbe Bank stellt, damit sie unter dem ersten nicht schräg umkippt.

Insgesamt ist die Übertragung des Münchner Originals auf Schaffhausen durchwachsen, mehr Schein als Sein. Aber dieser Schein zählt. Als ich zwei weitere Frauen frage, warum sie heute hier sind und ein Dirndl dafür tragen, geben sie irritiert zurück, das gehöre einfach dazu, es sei Oktoberfest. Vermutlich liegt genau darin die Wirkmacht des Fests: Es muss weder erklärt noch in Schaffhausen verankert werden, sondern ist soziales Theater, das die meisten einfach mitspielen können. Und der Tiefgang, den ich hier suche, liegt bestenfalls am Boden des Masskrugs: Insgesamt gehen an den drei Tagen gemäss Veranstalterin 2480 Liter Bier über die Theke.
Das ist ein Teil der skeptischen bis strikt ablehnenden Haltung zum Oktoberfest, die ich unter meinesgleichen spüre: Die Kombination aus rauen Mengen Alkohol und rauen Mengen Menschen führt jedes Jahr zu Grenzüberschreitungen und Gewalt. Aus diesem Grund gibt es in München inzwischen die Aktion «Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen».
Der andere Teil ist, wie geschichtsvergessen die Tradition gefeiert und reproduziert wird – gerade als Inbegriff deutscher Leitkultur. Das vermeintlich zeitlose Dirndl zum Beispiel wurde während der Zeit des Nationalsozialismus verkürzt, verschlankt und ideologisch instrumentalisiert: die Frau als fruchtbare Hüterin nationaler Identität. Und den «Zicke-zacke»-Trinkspruch zum Beispiel, scheinbar harmloses Gaudi, hat einst der berühmteste Marschliederkomponist des Dritten Reichs populär gemacht – und zwar für die Wehrmacht. Dass beides Jahr für Jahr im Zeichen harmloser Folklore fortgeschrieben wird, gehört längst selbst zur Tradition.
Am kleinen Bocktoberfest in Schaffhausen beobachte ich an diesem einen Abend keine Gewaltvorfälle. Auch die Veranstalter:innen und die Schaffhauser Polizei melden am ganzen Bocktoberfest-Wochenende keine Gewalt. Was aber fest steht: Der Argwohn hilft nicht, um an diesem Abend Anschluss zu finden.
Spielereien
Auf der Toilette, die mit «Dirndl» angeschrieben ist, spricht mich eine Frau Mitte 20 an. Ich sähe viel zu cool aus für diesen Ort mit dem offenen Hemd und den Cord-Hosen, was ich hier tue? Sie stellt sich mit dem Namen Cindy vor und trägt unter dem grün schimmernden Dirndl ein Spitzen-Top und Docs an den Füssen. Und was macht sie hier? «Ein Date, aber ein paar Freunde von ihm sind auch dabei. Ich glaube nicht, dass es etwas wird.» Ich frage, ob ich trotzdem zur Gruppe dazukommen darf.
Cindy, die noch nie an einem Oktoberfest war und sich als Feministin bezeichnet, hat eine Erklärung für die anhaltende Begeisterung um das Volksfest. «In Zeiten grosser Unsicherheit ziehen sich die Leute auf das Einfache zurück. Am Oktoberfest ist alles so, wie manche es gern immer hätten: Dirndl und Lederhosen, Mann und Frau.» Man sieht auf dieser Bühne Oktoberfest tatsächlich nur zwei Archetypen, sage ich. «Genau», sagt Cindy, «es gibt die, die hierher gehören und die anderen.»


Manchmal werden die vermeintlich so starken Codes untergraben. Von der einen jungen Frau beispielsweise, die in Lederhosen kommt, oder von dem Mann um die 30, der eine Endometriose-Schleife an seine Weste gesteckt hat. Oder von einer Frau Mitte 40, die mich zwei Mal um einen Zettel meines Notizblocks fragt, darauf «Regenbogenfahne von Kerstin Ott» schreibt und mich anweist, ihn dem Band-Leader als Liederwunsch zu überreichen. Sie selber sei zu schüchtern. Aber: «Auch das gehört zum Oktoberfest», sagt sie. Sie kommt, wie ihre Freundinnen, aus Brasilien. «Den Karneval in Rio mochte ich nie», sagt sie. Aber bei den Wiesn habe sie sich wohl gefühlt. Warum, kann sie nicht sagen. Wir beobachten schweigend, wie die in die Höhe gehalteten Masskrüge im Scheinwerferlicht leuchten.
Kurz bevor ich gehe, sehe ich, wie sich draussen eine Gruppe Männer um eine Maschine versammelt hat, welche die Stärke eines Fussballkicks misst. Zwei Frauen halten im Dunkeln glimmende Zigaretten in den Händen. Und Cindy diskutiert mit dem städtischen Finanzreferenten Kapitalismuskritik. Mittlerweile ist es halb 11. Mit Tradition hat das Bocktoberfest wenn, dann nur marginal zu tun: Es ist weniger Feier einer Tradition als vielmehr ein Spiel mit derselben. Für Ekstase und Albernheiten reicht es allemal – wenn man Zugang dazu hat. Und selbst wer das Fest skeptisch betritt, findet darin die eine oder andere Verbündete.
Wir schenken Dir diesen Artikel. Aber Journalismus kostet. Für nur 40 Franken gibt es die AZ probeweise für drei Monate: Hier geht es zum Probe-Abo. Oder zahl uns via Twint einen Kafi: