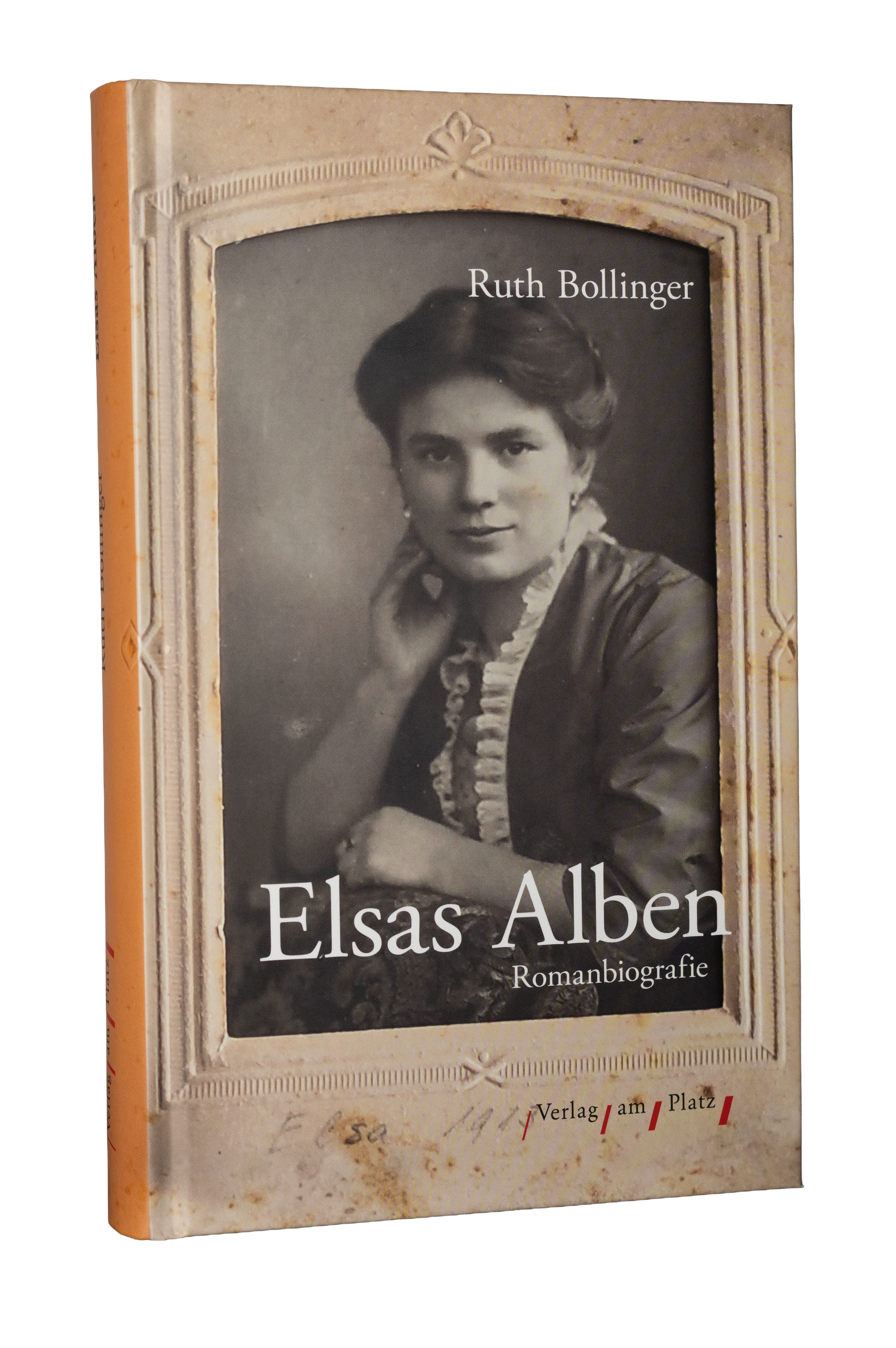Der Regierungsrat will dem Fachkräftemangel in Psychiatrie und Psychologie entgegenwirken.
Dabei kriselt es intern: Gegen den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst wurde eine Untersuchung eingeleitet.
Wer in Schaffhausen psychisch krank wird, stösst schnell an die Grenzen des Systems. Zu diesem Schluss muss kommen, wer die neuesten Zahlen zur psychiatrischen und psychologischen Versorgung im Kanton liest.
Im ganzen Kanton arbeiten am Stichtag, dem 26. Mai dieses Jahres, insgesamt 46 Psycholog:innen und 18 Psychiater:innen; letztere leisten zusammen ein Pensum von etwas mehr als zehn Vollzeitstellen. Gemessen an der Bevölkerungszahl ist das weniger als die Hälfte des schweizerischen Durchschnitts. Die Folge: Wer Hilfe braucht, muss sich oft auf lange Wartezeiten einstellen – oder sie im Nachbarkanton suchen, wo der Weg länger und die Konkurrenz grösser ist.
Das Fachpersonal ist wenig, und es wird noch weniger. Stand jetzt sind drei Viertel dieser Schaffhauser Psychiaterinnen und Psychologen entweder schon im Pensionsalter – oder sie stehen kurz davor. Das bedeutet, dass sich die Lage in den kommenden Jahren noch verschärfen wird, und das in einer Zeit, in der die Nachfrage nach psychologischer und psychiatrischer Unterstützung eher noch steigt. Zwei Psychologinnen bestätigten kürzlich gegenüber Radio Rasa, dass sie mehrmals täglich Anfragen neuer Patient:innen abweisen müsse.
Es gibt auch andere Hinweise darauf, dass das bestehende Angebot nicht ausreicht. Die Zahl der Hospitalisierungen nimmt zu; bei der jährlichen Anzahl Suizide steht Schaffhausen im nationalen Vergleich an fünfter Stelle, bei der Anordnung fürsorgerischer Unterbringungen an dritter (siehe AZ vom 26. Januar 2023). Und aktuell lassen sich jedes fünfte Kind und jede dritte Erwachsene ausserkantonal behandeln – auch diese Zahl ist in den vergangenen Jahren konstant gestiegen.
Die Säulen stärken
Die Entwicklung ist an sich nicht neu. Schon als der Regierungsrat vor zehn Jahren ein Psychiatriekonzept verabschiedete, zeichnete sich ab, dass der Kanton auf einen Personalengpass zusteuert. Vergangenes Jahr überwies der Kantonsrat zwei Postulate von Tim Bucher (GLP), Corinne Ullmann (SVP) und Ulrich Böhni (GLP), welche Sofortmassnahmen und eine langfristige Strategie im Bereich der psychischen Gesundheit verlangten.
Darauf hat der Regierungsrat nun reagiert: 2024 gab das Departement des Innern (DI) – damals unter SP-Regierungsrat Walter Vogelsanger – dem Zürcher Büro Verbali Consulting den Auftrag, die psychiatrische Versorgung im Kanton genauer anzuschauen. Auf dieser Grundlage hat das DI – inzwischen unter Marcel Montanari (FDP) – Massnahmen entworfen, die einen Teil dieser Probleme auffangen sollen. Ziel der Übung ist es, die vier Säulen der psychiatrischen Versorgung zu stärken: ambulante, intermediäre und stationäre Angebote sowie die Säule der Prävention.
Insgesamt will der Regierungsrat rund 476 000 Franken als jährlich wiederkehrende Ausgaben ins kantonale Budget aufnehmen, um die psychologische und psychiatrische Versorgung im Kanton zu stärken. Dazu kommen für eine Massnahme einmalig 90 000 Franken.
Hauptsächlich sollen mit diesem Geld Weiterbildungen zur Fachärztin respektive zum Fachpsychologen finanziert werden. Brisant dürfte aber eine andere Massnahme sein: 42 000 Franken jährlich soll in den Aufbau eines ambulanten Angebotes für 16- bis 25-Jährige fliessen; eine Altersgruppe, die bis jetzt zwischen Kinder- und Erwachsenenpsychiatrie durchs Raster fällt.
Zum Massnahmenpaket des Kantons
In der Vorlage hat der Regierungsrat, gestützt auf einen Bericht der Verbali Consulting, Massnahmen skizziert, welche die psychiatrische und psychologische Versorgung im Kanton stärken sollen:
– Mit 190 000 Franken pro Jahr will der Kanton Weiterbildungen von angehenden Psychiater:innen und Psycholog:innen subventionieren – pro Person sind 40 000 Franken vorgesehen. Pflegefachkräfte, die sich psychiatrisch weiterbilden wollen, erhalten Unterstützung von 20 000 Franken pro Jahr. Im Gegenzug verpflichten sich diese, nach Abschluss der Weiterbildung mindestens drei Jahre im Kanton zu arbeiten.
– Ein psychiatrischer Konsiliardienst soll Leistungserbringer wie Spitex, Pflegeheime und Hausärzt:innen unterstützen. Der Ausbau dieses Dienstes beziffert der Regierungsrat mit 200 000 Franken pro Jahr.
– Für 20 000 Franken jährlich und einmalig 90 000 Franken soll ein digitales Verzeichnis der im Kanton verfügbaren Angebote erstellt werden.
– Ein Netzwerk mit allen Akteur:innen der psychiatrischen Versorgung soll etabliert werden – dies gibt es bis anhin nicht. Kosten soll es jährlich 15 000 Franken.
– Schliesslich soll überprüft werden, ob im Kanton ein ambulantes Angebot für 16- bis 25-Jährige geschaffen werden kann. Die Kosten dafür schätzt der Kanton auf rund 42 000 Franken pro Jahr.
Das vorliegende Paket würde jährlich 467 000 Franken kosten, plus die einmaligen Kosten für das digitale Verzeichnis. Ob es zustande kommt, entscheidet der Kantonsrat. Die Verbali Consulting empfahl weitere Massnahmen, die der Regierungsrat aber nicht übernahm (der gesamte Bericht ist auf sh.ch einsehbar). Das kritisiert Co-Postulent Tim Bucher. Er sagt, dass ein erheblicher Teil der Forderungen in seinen Postulaten nicht umgesetzt worden sei – unter anderem Massnahmen zur Prävention oder die Überprüfung beispielsweise der Kriseninterventionsstelle. Zudem stellt er in Aussicht, dass er eine Aktualisierung des Psychiatriekonzeptes fordern wird.
Auffällig ist, wer sich für dieses Angebot aus dem Rennen nimmt: der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst (KJPD). Der wichtigste und de facto einzige Akteur in der psychiatrischen Versorgung dieser Altersgruppe komme, so heisst es im Bericht, «aktuell nicht als Partner für den Aufbau eines solchen Angebots in Betracht». Bei «veränderten Rahmenbedingungen» könne dies erneut beurteilt werden. Vorerst streckt der Kanton seine Fühler in Richtung des Sozialpädiatrisches Zentrums des Kantonsspitals Winterthur sowie der Integrierten Psychiatrie Winterthur aus.
Warum der KJPD ausgeschlossen ist, bleibt von offizieller Seite her offen. Die Spitäler Schaffhausen erklären lediglich, dass die sogenannte Adoleszentenpsychiatrie eine eigene Subdisziplin sei und der KJPD für diese Patient:innen nicht die passende Institution sei. Das kantonale Gesundheitsamt wiederum sagt, dass es im Ermessen der Spitäler liege, ein solches Angebot zu schaffen – der Regierungsrat beantrage mit der Vorlage lediglich, dass er derartige Angebote unterstützen könne.
Der KJPD in der Kritik
Offenbar rumort es rund um den KJPD schon länger. Wie die AZ weiss, läuft seit vergangenem Sommer eine externe Untersuchung gegen die Fachstelle des Spitals. Auftraggeber ist das Gesundheitsamt. Der Auslöser: Fachpersonen aus dem Kinder- und Jugendbereich kritisieren strukturelle Mängel.
Weder die Spitäler noch das Gesundheitsamt bestätigen die Untersuchung auf Nachfrage. Die AZ hat aber mit mehreren Fachpersonen auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendpsychologie im Kanton gesprochen, die regelmässig mit dem KJPD zusammenarbeiten.
Namentlich in der Zeitung genannt werden will keine dieser Personen oder Fachstellen. Einerseits, weil die Untersuchung bereits angelaufen ist und man sich Besserung davon erhofft, andererseits weil man sich die Zusammenarbeit nicht verscherzen will – die Abhängigkeit vom KJPD ist hoch und ein Anreden gegen ihn «politisch heikel», wie es eine Person sagt. Die Aussagen decken sich aber zu grossen Teilen: Die Zusammenarbeit mit dem KJPD sei, so ist zu hören, immer wieder schwierig.
Kritisiert werden unter anderem problematische Prozesse im KJPD. Schon das Triage-System funktioniere nicht gut: Ob eine Behandlung notwendig ist, entscheide der KJPD oftmals aufgrund der (primär telefonisch gemachten) Äusserungen der Eltern – ohne das Kind oder andere Fachkräfte wie Lehrerinnen oder Sozialarbeiter, die bereits mit ihm in Kontakt stehen, anzuhören. Jugendliche können sich, so beschreibt es eine Sozialarbeiterin, nicht selbständig anmelden; auch hier lege der KJPD den Fokus aufs Einverständnis der Erziehungsberechtigten.
Zudem bestätigen Fachstellen ein Problem, von dem in der AZ vergangenen Monat im ADHS-Bericht schon zu lesen war: Der KJPD stelle oftmals keine Diagnose, sondern erkläre die Probleme eines Kindes für sozial oder schulisch indiziert und leite daraus entsprechende – nichtmedizinische – Massnahmen ab. Eine Fachperson aus dem Jugendbereich bezeichnet dies als «Haltungsproblem» betreffend Diagnosen, welches dazu führe, dass bestehende Angebote für Kinder und Jugendliche in Schaffhausen mit sehr komplexen Fällen konfrontiert seien. «Teilweise kommen Jugendliche zu uns, die suizidal sind. Uns fehlen aber die Kompetenzen für sie, zuständig wäre der KJPD», sagt eine Sozialarbeiterin.
Dieser Ansatz des KJPD stösst also auf Kritik – auch von Elternseite. Nachdem die AZ im vergangenen Monat schon über den Umgang mit ADHS-Diagnosen berichtete, sprach sie nun mit zwei weiteren Familien aus dem Kanton, die mit dem KJPD zu tun hatten. Beide werfen dem Dienst vor, ihren Kindern unpassende Massnahmen verordnet zu haben.
In der einen Familie sind gleich mehrere Kinder inzwischen mit ADHS diagnostiziert – die Diagnosen stammen aber nicht aus Schaffhausen, sondern aus einer Privatklinik im Kanton Zürich. «Am KJPD hiess es, dass es unserem Kind aufgrund der familiären Situation nicht gut gehe. Für eine Diagnose sei dies zu wenig», erzählt eine Mutter der AZ. «Wir wechselten den Arzt, und der sah, wie sehr unser Kind litt: Es hatte kein Selbstbewusstsein, keine Hobbies und Freundschaften mehr und weigerte sich, zur Schule zu gehen.» Die Diagnose und die daraufhin verschriebenen Medikamente hätten zu einer derartigen Stabilisierung geführt, dass das Kind inzwischen die Kantonsschule Schaffhausen besuche.
Eine zweite Mutter schildert ähnliche Erfahrungen. Sie machte mit ihrem Kind denselben Weg: erst ans KJPD, nach zwei Jahren nach Winterthur. «Der KJPD redete oft um den heissen Brei herum und nannte uns keine Diagnose», erzählt sie. «Das war für uns sehr belastend. Mit dem Nichtstun des KJPD verlor unsere Tochter wertvolle Zeit. Es wäre in diesem Fall wichtig gewesen, mit der Medikation zu beginnen und erst dann weitere Massnahmen wie Ergo- oder Verhaltenstherapie anzuordnen.»
An der Überforderung und Frustration, die beide Eltern zum Ausdruck bringen, wird auch eine Systemfrage deutlich: Unabhängig davon, für wie sinnvoll man Diagnosen halten mag, erhalten Kinder unter Umständen erst mit einer solchen schnelle Hilfe, wenn sie in eine Abwärtsspirale geraten sind. «Die Frage, wie man mit Diagnosen umgeht, ist auch eine gesellschaftspolitische», fasst dies eine Fachperson aus dem psychologischen Kinder- und Jugendbereich zusammen. «Eine kritische Haltung gegenüber Diagnosen hat durchaus etwas Gutes. Der Austausch über verschiedene Haltungen unter Fachpersonen wäre aber wichtig, um etwaige Missverständnisse zu klären. Das System, in dem wir alle uns bewegen, ist stark auf Diagnosen angelegt – solche strukturellen Bedingungen müssen mitgedacht werden, weil sie sich auf die Zusammenarbeit unter Fachpersonen und mit Eltern auswirken.»
Der grosse Spachtel kommt erst
Die AZ hätte gerne direkt mit dem KJPD über die Kritik gesprochen. Die Spitäler Schaffhausen wiesen dies ab: Chefarzt Jan-Christoph Schaefer sei nicht der richtige Adressat für die Anfrage. Die Kommunikationsabteilung der Spitäler sowie auch das Gesundheitsamt nehmen keine Stellung zur eingeleiteten externen Untersuchung. Sie weisen aber beide darauf hin, dass die gesamte psychiatrische Versorgung des Kantons aktuell überprüft werde.

Die Spitäler wie auch das Departement des Innern unter Marcel Montanari wollen ein neues Gesamtkonzept ausarbeiten, das Anfang des kommenden Jahres vorliegen solle. Darin soll nicht nur der – im jetzigen Massnahmenpaket ausgelagerte – Bereich Adoleszentenpsychiatrie neu beurteilt werden. Auch bezüglich der Zukunft der Breitenau soll bald informiert werden. Denn im Spitalneubau, für den vor rund zwei Wochen Baueingabe war (AZ vom 2. Oktober 2025), ist ein allfälliger Neubau für die Psychiatrie auf dem Geissberg noch nicht mitgeplant.
Anders gesagt: Mit dem grossen Spachtel werden die Säulen der psychiatrischen Versorgung im Kanton wenn, dann erst ab nächstem Jahr saniert.
Befinden Sie sich in einer Krise oder haben Sie Suizidgedanken? Die Dargebotene Hand kann helfen. Sie ist unter der Telefonnummer 143 sowie im Internet via 143.ch erreichbar. Für Kinder und Jugendliche ist das Angebot von Pro Juventute da: Telefon 147 oder 147.ch.
Wir schenken Dir diesen Artikel. Aber Journalismus kostet. Für nur 40 Franken gibt es die AZ probeweise für drei Monate: Hier geht es zum Probe-Abo. Oder zahl uns via Twint einen Kafi: