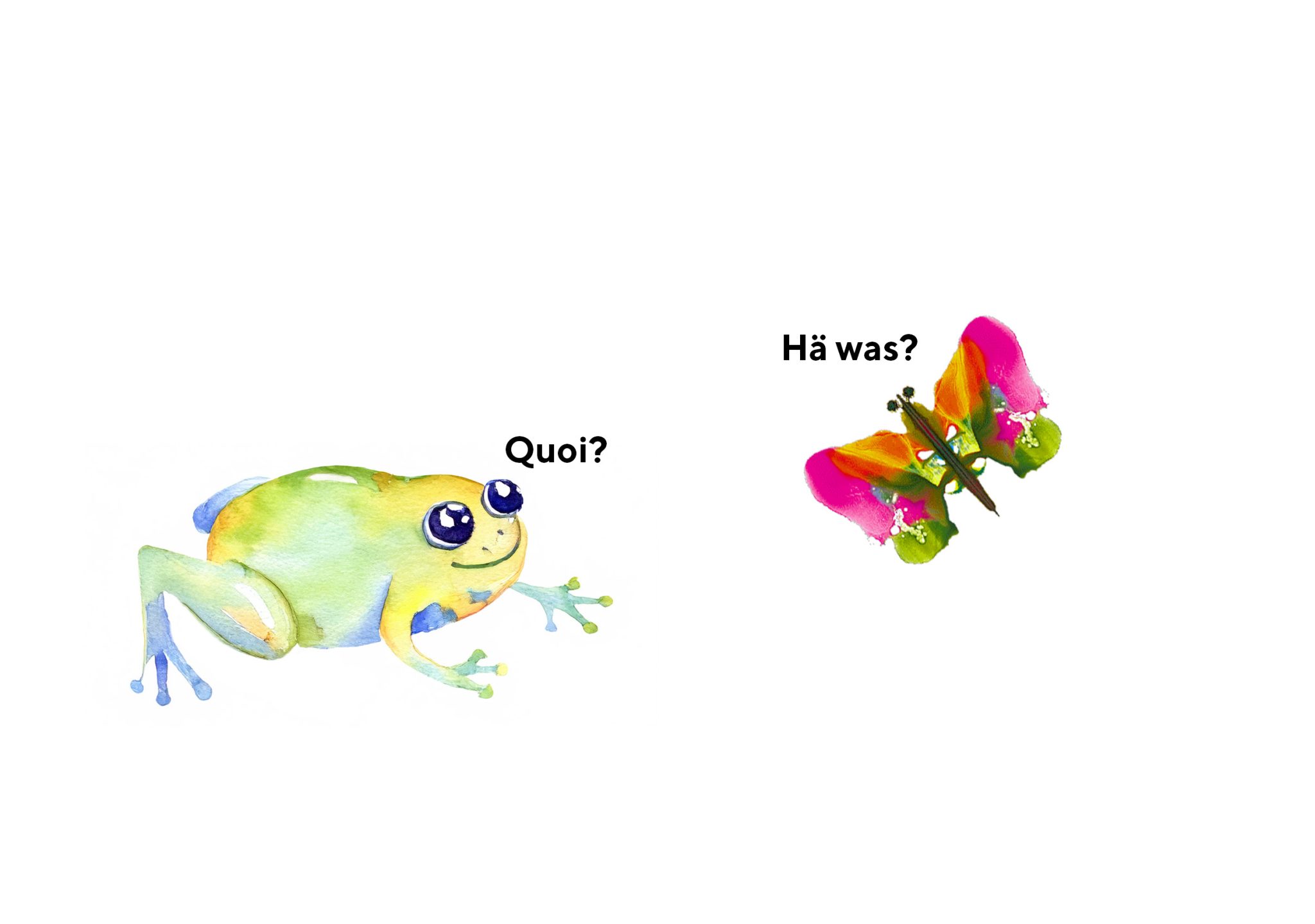Die Deutschschweiz streitet übers Frühfranzösisch. Nun fordert ein
Schaffhauser Vorstoss das Aus der Landessprache auf Primarstufe.
Wir haben uns umgehört: Die Meinungen könnten nicht unterschiedlicher sein.
Aufgezeichnet von Fabienne Niederer
Fabrice Bischoff, Gastronom
«Stell dir vor, wir zwei müssten miteinander Englisch reden, weil wir uns nicht verstehen, dabei sind wir beide in der Schweiz.»
Ich bin 2007 aus dem Waadtland hierher nach Schaffhausen gekommen, wegen Heidi, meiner Ehefrau. Sie machte damals einen Austausch in der Westschweiz und wir arbeiteten zusammen im gleichen Restaurant. Gemeinsam sind wir in die Deutschschweiz zurückgekehrt, sie kommt aus Stein am Rhein. Heute führen wir die Wirtschaft zum Frieden.
Meine Frau hilft mir auch jetzt manchmal, indem sie simultan übersetzt: Sie hatte damals noch einen Französischlehrer der «alten Schule», also viel Wörtli lernen und Grammatik pauken. Was sie aber nicht lernte, war das freie Sprechen. Da hat der Austausch sehr geholfen, zuerst drei Wochen in Frankreich und später eben in der Westschweiz. Ich gebe zu, Deutsch hat mir in der Schule nie gefallen – ich war sehr schlecht darin und dachte, ich bräuchte es bestimmt nie. Und dann sind wir hier gelandet. Meine Kenntnisse sind noch immer nicht ganz optimal, deshalb besuchte ich lange einen Sprachkurs hier, jede Woche ein, zwei Stunden, um mich zu verbessern. Zum Glück hatte ich Hilfe von Heidi – aber es gibt auch sehr viele Leute hier in Schaffhausen, die super Französisch reden, unser Nachbar zum Beispiel. Sie geben sich viel Mühe, mir entgegenzukommen. Das ist bei Westschweizern ganz anders: Die versuchen nicht einmal, Deutsch zu sprechen. Wenn Touristen zu uns ins Restaurant kommen wollen, reden sie am Telefon oft einfach drauf los – auf Französisch, versteht sich. Sie sind dahingehend ein bisschen festgefahren, das habe ich hier bei Schaffhausern anders erlebt.
Jetzt aber das Frühfranzösisch abzuschaffen, fände ich sehr schade. Besonders, wenn ich merke, wie viele Leute der älteren Generationen sich Mühe geben, mit mir Französisch zu sprechen. Gerade auch in Hinblick auf unsere Kultur ist das traurig – immerhin sind sowohl Deutsch als auch Französisch Landessprachen von uns. Stell dir vor, wir zwei müssten jetzt Englisch miteinander reden, weil wir uns nicht verstehen, dabei sind wir beide in der Schweiz.
Ich finde, beide Seiten, also die Deutsch- und die Westschweiz, müssen daran festhalten, früh die Fremdsprache zu lernen. Je früher man anfängt, desto besser bleibts hängen. «C’est un donner et un prendre», sagt Heidi dazu. Ein Geben und ein Nehmen. Nur weil mein Deutsch nicht perfekt ist, heisst das nicht, dass man es nicht probieren sollte.
Und dass man auf Englisch zurückgreift, scheint immer öfters zu passieren: Gerade letzte Woche war ich in einem Restaurant in Zürich und habe begonnen, auf Deutsch zu bestellen. Da haben sie einfach Englisch mit mir geredet. Ist das nicht komisch?
Markus Fehr, SVP-Kantonsrat
«Wir haben schon 15 Jahre lang mit dem Konzept Frühfranzösisch experimentiert. Das Resultat ist ernüchternd.»
Als ich zur Schule ging, lernte man Französisch ab der ersten Oberstufe und konnte ab der zweiten noch Englisch dazu wählen. Ich hatte den Französischunterricht nie gern. Es war das Fach, das den meisten Aufwand für mich bedeutete – und bei dem ich am ehesten dachte, dass ich es später nicht gross brauchen würde. Anders war das beim Englisch: Das fiel mir viel leichter, ich habe es bewusst gewählt und gesehen, wie wichtig die Sprache später für mich sein könnte, beim Reisen oder für den Beruf etwa. Französisch wird hingegen in der Politik oft erst auf nationaler Ebene relevant.
Klar, sie ist eine Landessprache, deshalb soll sie als Fach auch bestehen bleiben. Ich bin aber der Meinung: Drei Jahre Unterricht reichen aus. Und dass der Lernstoff durch ein Zurückschieben in die Oberstufe geballt würde, glaube ich nicht. Es gibt verschiedene Belege dafür, dass sich der ganze Stoff aus der fünften und sechsten Klasse in wenigen Monaten bereits aufholen lässt. Aus der Primarschule bleibt, so scheint es, nicht sehr viel hängen. Auch die kognitiven Fähigkeiten sind in der Oberstufe ausgereifter: Die Studie «Alter und schulisches Fremdsprachenlernen» von Amelia Lambelet und Raphael Berthele weist darauf hin, dass im schulischen Kontext ältere Lernende einen Startvorteil haben. Sie lernen schneller als die jüngeren. Man müsste so richtig eintauchen können in die Fremdsprache, zwei, drei Lektionen pro Woche sind dafür nicht genug. Aber Ausflüge mit der Klasse, eine Schulverlegung in die Westschweiz, das könnte ich mir als hilfreich vorstellen. Man lernt am meisten, wenn man diesen Sprachraum um sich herum hat.
Wir haben schon 15 Jahre lang mit dem Konzept Frühfranzösisch experimentiert. Das Resultat ist ernüchternd: Es war gut gemeint, ist aber nicht gut rausgekommen. In zwölf der 19 deutschschweizer Kantone sind entsprechende parlamentarische Vorstösse pendent oder bereits überwiesen worden. Nun ist Schaffhausen gefragt.
Dr. Bettina Imgrund, Dozentin PHSH
Fachbereich Französisch(-Didaktik)
«Eine Verschiebung des Französisch in die Oberstufe würde das Problem des tiefen Niveaus nur vergrössern.»
Es stimmt, dass Französisch sicher eine recht anspruchsvolle Sprache im Unterricht ist. Die Syntax von Französisch ist anders, die Aussprache und Wörtli sind schwerer zu lernen. Deshalb kann ich sehr gut verstehen, weshalb jemand wie Patrick Strasser (siehe Box) vorschlägt, statt Französisch lieber Englisch in die Oberstufe zu verschieben. Aber die Schweiz ist in Europa jenes Land, das beispielhaft für Mehrsprachigkeit steht – deshalb muss Französisch auf der Primarstufe erhalten bleiben.
Was ich mir vorstellen könnte, ist, die beiden Fremdsprachen zu tauschen: Französisch bereits ab der dritten Klasse und Englisch ab der fünften. Eine Verschiebung von Französisch in die Oberstufe nützt vermutlich wenig, im Gegenteil: Es würde das Problem des tiefen Niveaus nur vergrössern. Sind Teenager mitten in der Pubertät begeisterungsfähiger als Primarschüler:innen? Wohl eher nicht. Dazu kommt ein zweites Problem: Wer soll diesen zusätzlichen Französischunterricht erteilen? Momentan ist Französisch in der Oberstufe für die Studierenden meist ein Wahlfach. Es wird selten gewählt, weil man auch ohne das Fach als Klassenlehrperson auf der Oberstufe unterrichten kann. Das heisst, dass der erhöhte Bedarf nach Seklehrpersonen, der durch ein Verschieben in die Oberstufe entstehen würde, wohl nur schwer gedeckt werden könnte.
Das aktuelle Lehrmittel «Dis donc!» ist grundsätzlich sehr gut, die methodische Aufarbeitung des Materials könnte allerdings verbessert werden. Wenn die Lehrperson die Bücher mit den Schulkindern eins zu eins durcharbeitet, arbeiten sie sehr oft in Partner- oder Gruppenarbeit und tauschen sich aus. Das geschieht dann schnell in der Muttersprache oder gar im Dialekt. Dabei müssten die Schüler:innen die Fremdsprache so oft es geht hören und vor allem auch selbst sprechen. Kinder sind eben keine Autodidakten – sie lernen entlang einer Aufgabe, vor allem aber auch mit der Lehrperson, und die hat heutzutage eher zu wenig Gewicht im Klassenzimmer.
Als Forscherin bin ich sehr besorgt über die schlechten Ergebnisse, die aktuell diskutiert werden. Ich weiss aber auch, dass es zwischen den Klassen deutliche Leistungsunterschiede gibt. Mit anderen Worten: Es gibt guten Französischunterricht und wir kennen die Qualitätsmerkmale, die guten Französischunterricht ausmachen. Wir wissen auch, dass Lehrpersonen die Qualität des Unterrichts erheblich beeinflussen können. An der PH Schaffhausen unterrichte ich meine Studierenden auf Basis von Erkenntnissen, die ich aus praxisorientierten Unterrichtsforschungen ableiten konnte. Ebendiese Erkenntnisse sind aber noch nicht flächendeckend eingeführt.
Ich persönlich hatte eine sehr gute Französischlehrerin, das war wichtig. Anschliessend hatte ich die Chance, einen Austausch zu machen, wir hatten eine Partnerschule, und zuhause hatte ich eine Brieffreundin aus Frankreich – diese Kombination aus guter Lehrperson, einem Austausch und einem aufgeschlossenen Elternhaus, das hat es ausgemacht für mich. Ein Austausch, wie ich ihn machen konnte, ist natürlich kein Allheilmittel – es ist eine Mischung aus Voraussetzungen. Und weil ein solcher Sprachaufenthalt in der Praxis sehr aufwendig ist, wäre mein Anliegen, dass wenigstens die Studierenden ein paar Monate ausserhalb studieren, in der Westschweiz zum Beispiel, und das Gelernte anschliessend mit ins Klassenzimmer bringen.

Stephan Keller, Winzer und Vater
«Wir Kinder waren verwirrt: Weshalb lernen wir Französisch, wenn hier alles um uns herum auf Englisch ist?»
Ich habe zwei Kinder, 13 und 15 Jahre alt. Ich bin dafür, das Frühfranzösisch abzuschaffen und erst in der Oberstufe damit zu beginnen. Es ist eine Landessprache, das stimmt. Aber wenn die Jugendlichen heutzutage unterwegs sind, ist es Englisch, das überall präsent ist.
Das war bei mir früher schon so: Ich habe mit Englisch erst in der zweiten Oberstufe angefangen, sehr spät. Französisch hatte ich hingegen ab der vierten oder fünften Klasse, und wir Kinder waren verwirrt: Weshalb lernen wir Französisch, wenn hier alles um uns herum auf Englisch ist – die Werbung, die Umgebung? Im Französisch war ich eine Niete, ich kann es heute noch nicht. Aber für die Berufswahl kann Englisch entscheidend sein. Meine 15-jährige Tochter ist zum Beispiel gerade auf Jobsuche und überall wird gefragt, ob sie denn Englisch beherrsche. Beide meine Kinder erzählen, dass sie lieber mehr Englischunterricht hätten, und davon, wie viel Spass sie daran haben. Dort gefällt ihnen, wie die Lehrpersonen den Stoff vermittelt. Dadurch interessieren sie sich viel mehr dafür und damit auch für den Lernstoff an sich.
Ich sehe: Meine Kinder haben heute viel mehr Stoff, das hat über die letzten Jahre zugenommen. Zwei Fremdsprachen so früh, das scheint mir zu viel zu sein, auch, wenn ich die beiden beobachte. Da müssen wir uns nicht fragen, weshalb die Jugendlichen immer öfter ausgebrannt sind.
Dimitri Egli, Oberstufenschüler
«In der Oberstufe hätte ich Französisch abwählen können – aber ich fand, dass ich mir alle Wege offen halten sollte.»
Ich bin jetzt 14 Jahre alt und bald mit der Oberstufe fertig. Französisch hatten wir seit der fünften Klasse, ich erinnere mich noch, dass mir das Fach am Anfang ziemlich schwer gefallen ist. Ich mag es noch immer nicht, aber eigentlich kann ich die Sprache relativ gut. Ich habe einfach das Gefühl, man braucht es fast nicht, vor allem in meinem Alter und erst recht gleich zu Beginn, in der fünften Klasse. Und trotzdem: In der Oberstufe hätte ich Französisch abwählen können, habe es aber absichtlich nicht getan. Irgendwie fand ich doch, dass ich mir alle Wege offen halten sollte, besonders für den Fall, dass ich in die Kanti gehen will. Und ich habe gemerkt: So schwer fällt es mir gar nicht mehr. Klar, ich könnte auch normal weiterleben, wenn ich kein Französisch gelernt hätte – aber vielleicht brauche ich es später einmal. Es ist generell cool, eine weitere Fremdsprache ausser Englisch zu können.
Wenn ich heute schon mitentscheiden könnte, ob man das Frühfranzösisch abschaffen soll? Das wäre schwierig. Einerseits fand ich schon praktisch, dass wir früh angefangen haben, das viele Voci-Lernen war damit aus dem Weg und in der Oberstufe konnten wir neue Sachen anschauen, Zeitformen zum Beispiel. Fiele das weg, müssten wir in der Sek alles gleichzeitig lernen und aufholen, und am Ende ist man zum Beispiel an der Kanti im Verzug, das wäre ein riesiger Stress. Mein alter Klassenlehrer hat uns auch erzählt, dass Kantilehrer teils erschraken, wenn sie sahen, wie stark die neuen Kinder im Französisch zurückliegen.
Andererseits habe ich das Gefühl, dass man auf Seklevel fast schon zu viel lernt, als man im Alltag und für den Beruf später brauchen könnte. Gerade wenn viele Schüler später in Handwerksberufe gehen. Ich finde auch, wenn man die Sprache wirklich gut lernen will, braucht man fast ein Austauschsemester.
Was für mich aber klar ist: Den Vorschlag, Englisch nach hinten zu schieben, finde ich nicht gut. Die Sprache braucht man viel, viel mehr als Französisch. Klar, man lernt es auch ausserhalb der Schule eher, ich habe zum Beispiel viel übers Internet mitgekriegt, Youtube unter anderem, das hat geholfen. Aber die ganzen Grammatikregeln, Wörtli lernen, da nimmt man das meiste aus der Schule mit. Erst ab Oberstufe anzusetzen, wäre wirklich keine gute Idee.
Wir schenken Dir diesen Artikel. Aber Journalismus kostet. Für nur 40 Franken gibt es die AZ probeweise für drei Monate: Hier geht es zum Probe-Abo. Oder zahl uns via Twint einen Kafi: