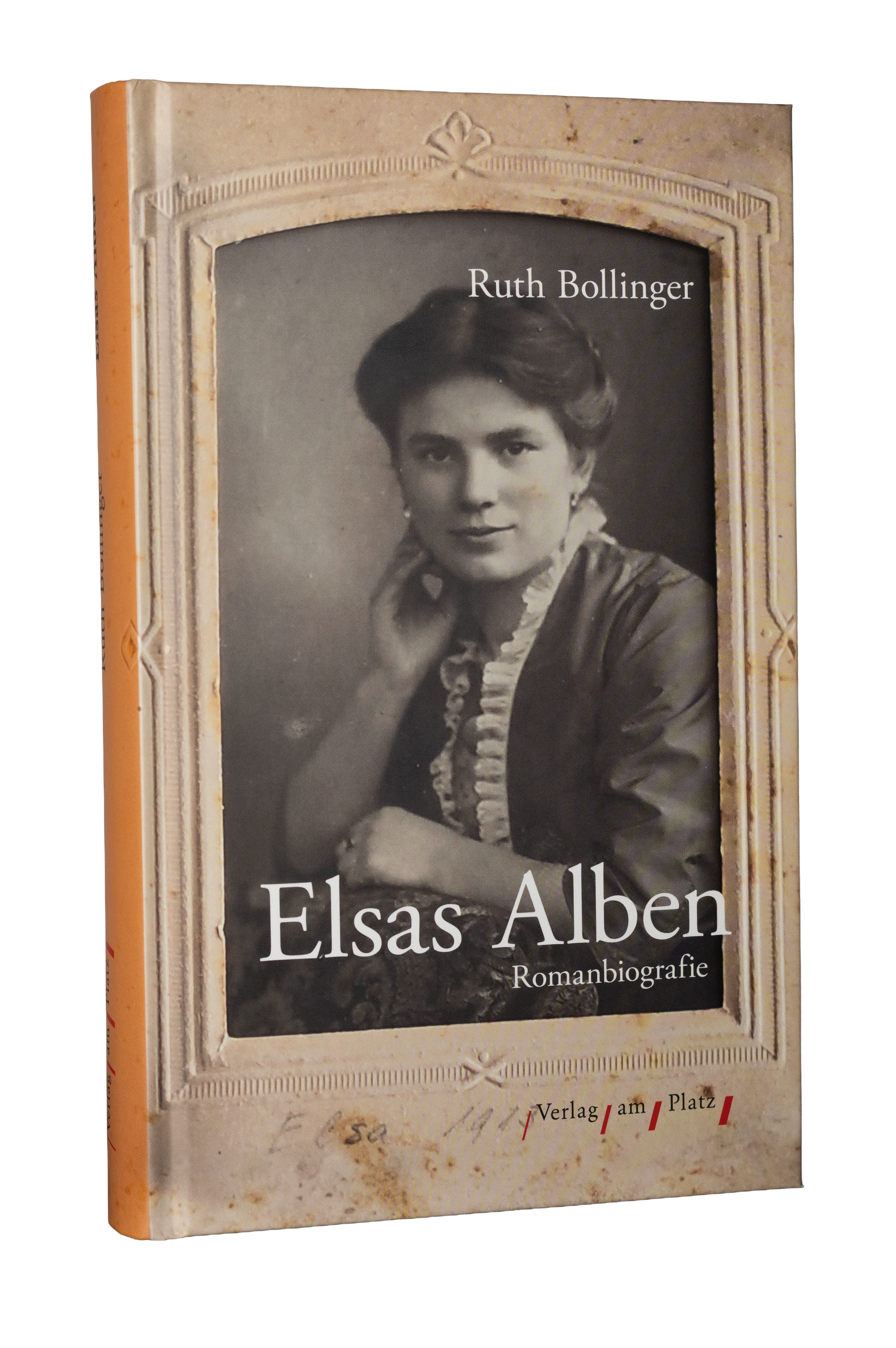Das umstrittene Kunstprojekt «hybride Stadtbank» ist beendet. Stadträtin Christine Thommen zieht zum ersten Mal persönlich Bilanz.
Interview: Nora Leutert
An diesem Mittwoch wurden die zersägten, gelben Sitzbänke auf dem Walther-Bringolf-Platz wieder zusammengeschraubt: Das Projekt der Künstlerbrüder Frank und Patrick Riklin, das eine Kontroverse verursachte – nicht über Kunst, sondern über Kosten und Zerstörung –, ist nicht mehr. Brav stehen die Bänkli da. Wir haben uns mit Sozialreferentin Christine Thommen hingesetzt:
AZ: Christine Thommen, verfolgen diese Bänkli Sie in Ihren Träumen?
Christine Thommen: Nein, mich verfolgt grundsätzlich nichts bis in meine Träume. Das ist vielleicht ein Privileg.
Das nun abgeschlossene Kunstprojekt hat sehr viel Kritik eingefahren. Mit welchen Gefühlen schauen Sie darauf zurück? Mit Enttäuschung? Verbitterung?
Mit mildem Bedauern. Die Vision war, eine offene Stadtbevölkerung zu fördern: Mit der Möglichkeit, eine Bankhälfte bei sich zu Hause aufzustellen und unbekannte Gäste zu empfangen, wollten wir unübliche Begegnungen fördern, Gedanken über öffentlichen und privaten Raum anregen und einen Diskurs anstossen. Unser Ziel war es, dass die Stadt vom Bänkli-Fieber gepackt wird. Das haben wir leider nicht erreicht.
Das Bänkli-Fieber ist in der Tat nicht ausgebrochen.
Die Abwehrkräfte waren aus diversen Gründen stark. Viele Leute wollten nicht, dass jemand Fremdes in ihr Wohnzimmer kommt. Die Zahl an Besuchen indessen war wesentlich grösser, da war die Hemmschwelle offenbar kleiner.
Sie schildern es so, als wäre das Kunstprojekt manchen Leuten zu radikal gewesen. Aber zuckten die meisten Städterinnen und Städter nicht viel eher nur mit der Schulter? Die Idee war banal.
Nun, andere Menschen nahmen die Aktion offenbar als Provokation wahr…
Das hatte vor allem mit dem Stadtrat selbst zu tun: An der Auftaktveranstaltung zerteilten Sie und ihre Amtskollegen die Bänkchen mit einer Motorsäge. Ihnen hätte doch bewusst sein müssen, wie explosiv so ein Auftritt ist.
Dass er explosiv werden würde, ja. Dies aber mit dem Ziel, Interesse und Neugier für das Projekt zu wecken. Dass viele Leute dies aber als blossen Akt der Zerstörung auslegen würden, sahen wir nicht kommen. Das bedauern wir.
Die Riklin-Brüder haben den Stadtrat wortwörtlich vor den Karren gespannt und sich über den provokativen Akt des Bänkli-Zersägens gefreut. Ist der Stadtrat den beiden Künstlern auf den Leim gegangen?
Nein, wir wussten, auf was wir uns einlassen. Wir sind alle lange genug in der Politik, um solch eine Aktion abzuwägen. Wir wollten uns auch nicht selbst inszenieren, sondern dem Projekt die Wichtigkeit verleihen, die es in unseren Augen verdiente. Rückblickend war es vielleicht etwas naiv zu denken, dass es auf Anklang stossen würde, wenn der Stadtrat bei etwas Unkonventionellem und Kultigem mitmacht, statt wie gewohnt eher sachlich zu agieren.
Stadtrat Daniel Preisig hat die Bänkli-Aktion letztes Jahr bei den Wahlen womöglich den Hut als Kantonsrat gekostet. Sie hingegen wurden kurz vor dem Start der Aktion mit gutem Resultat wieder in den Stadtrat gewählt. Sind sie glimpflich davongekommen?
Dass die Bänkli-Aktion Daniel Preisig geschadet hat, ist eine Mutmassung. Und was mich betrifft: Ich mache meine Politik nicht mit Blick darauf, ob sie mich Stimmen kostet oder nicht. Natürlich handle ich nicht blindlings, aber wenn ich von etwas überzeugt bin, packe ich es an. Und bestenfalls gefällt das der Stimmbevölkerung (lacht).
Das eine oder andere war doch etwas ungeschickt bei der Bänkli-Aktion: Gleich zu Anfang gab es im Stadtparlament Rabatz, weil Sie Infos zum Projekt vor der GPK zurückhielten. Würden Sie das im Nachhinein anders machen?
Es gab einen Grund dafür, dass wir die Überraschung noch nicht ausplaudern wollten. Ich bereue das nicht.
Auch, dass der Walther-Bringolf-Platz gerade eine Baustelle ist: unglücklich. Es ist unwirtlich und laut hier. Und es stinkt nach Kehricht, riechen Sie es?
Nein, (schnuppert). Doch, jetzt (lacht). Es war ein Teil des Projekts, den Platz trotz Baustelle mit einer Zwischennutzung zu beleben. Und es funktioniert: Der Umbau hat die Leute nicht gestört, die Bänkli werden gut genutzt.
Das zeigt vor allem, dass es zu wenig Bänkli in der Altstadt gibt. Ursprünglich war geplant, dass die Bauarbeiten auf dem Bringolf-Platz bei Projektstart zum Teil bereits abgeschlossen sind, nicht?
Tatsächlich kam es immer wieder zu Änderungen, wir mussten flexibel bleiben.
Rückblickend: Würden Sie das Bänkli-Projekt nochmals starten?
Ich würde es nochmals tun, weil ich aus der Überzeugung handelte, es sei etwas Gutes für die Stadt. Doch mit dem Wissen von heute würde ich es anders angehen.
Was würden Sie anders machen?
Ich würde besser kommunizieren, um was es uns eigentlich geht, nämlich ein offenes Miteinander zu fördern.
Haben Sie aus der ganzen Sache persönliche Lehren gezogen?
Ich werde mich weiterhin für eine offene Stadtbevölkerung einsetzen und innovative Wege beschreiten. Aber ganz so experimentierfreudig wäre ich wahrscheinlich nicht mehr.
Haben Sie sich ein wenig die Finger verbrannt?
Nein. Aber das Ganze war der Sache – eben dem sozialen Miteinander – nicht so dienlich, wie ich mir das erhofft hatte.
Ein grosser Wirbel wurde um die Kosten veranstaltet: In seiner Medienmitteilung zum Abschluss konnte sich der Stadtrat deshalb nicht verkneifen, dass das Projekt nur 2 Franken pro Einwohner kostete. Man habe unterschätzt, dass dies als Steuergeldverschwendung gewertet werden könnte.
Ich nehme es ernst und verstehe, dass die Zahl von 100 000 Franken viel Geld ist. Ich finde es aber schade, dass die Projektkosten zum Hauptthema wurden und die Auseinandersetzung mit dem Inhalt in den Hintergrund trat.
Tatsächlich erhielt man im vergangenen Dreivierteljahr den Eindruck, die Stadt habe das Projekt nach all den negativen Rückmeldungen nicht mehr an die grosse Glocke gehängt.
Diesen Eindruck kann ich nicht nachvollziehen. Wir Stadträte nahmen am Austausch auf den Bänkli teil, posteten Bilder davon in den Sozialen Medien. Wir haben uns ja auch nie distanziert von dem Projekt, im Gegenteil.
Ist das Geld der Künstler jetzt eigentlich aufgebraucht?
Ja, aber nicht überschritten.
Wir schenken Dir diesen Artikel. Aber Journalismus kostet. Für nur 40 Franken gibt es die AZ probeweise für drei Monate: Hier geht es zum Probe-Abo. Oder zahl uns via Twint einen Kafi: