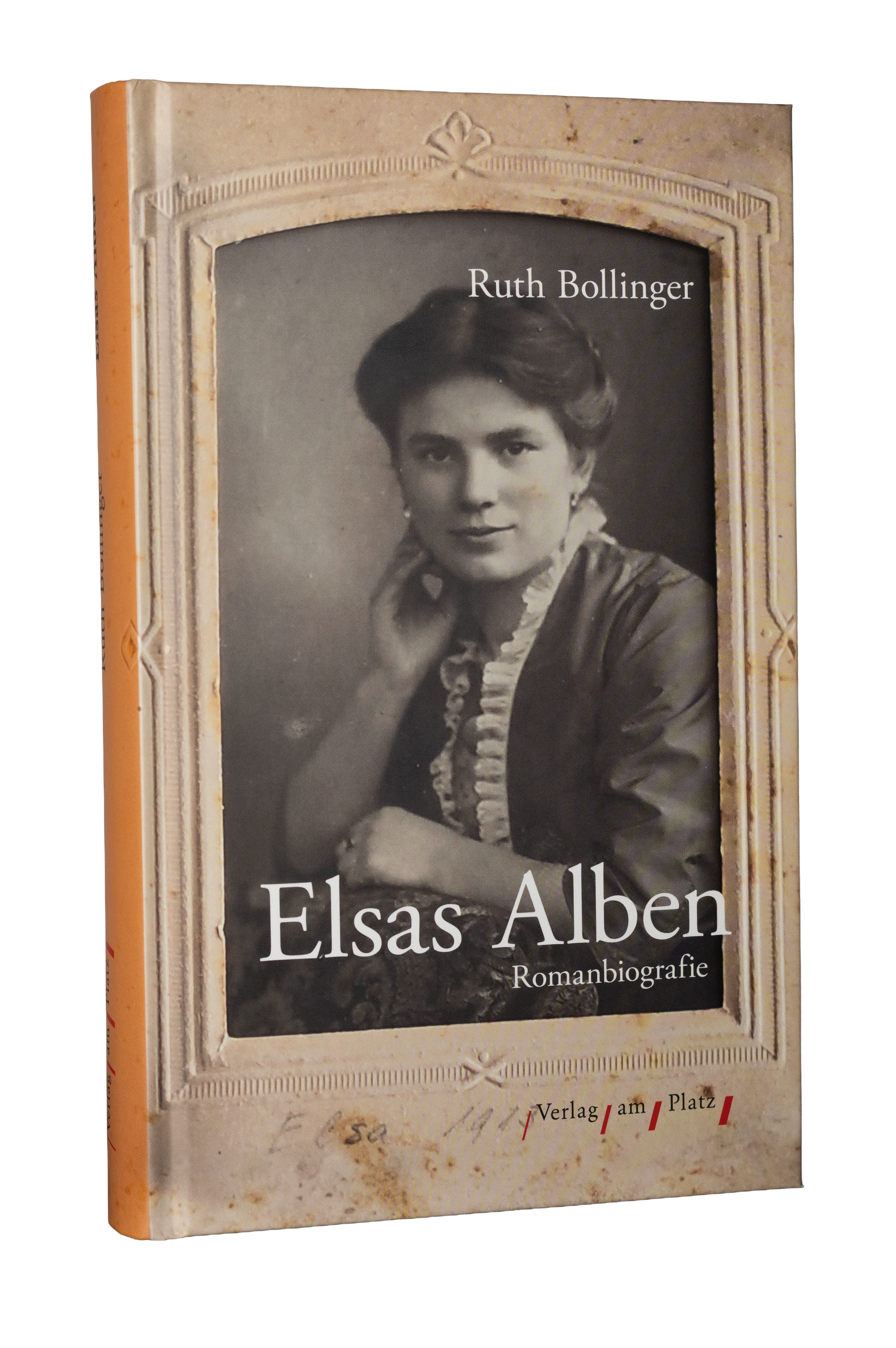Keine psychische Störung steht derzeit so stark im Fokus der Öffentlichkeit wie ADHS. Warum eigentlich? Eine Tour d’Horizon mit Ärzten, Forschenden und Betroffenen aus der Region gibt Einblick – und zeigt, wie wenig wir über ADHS tatsächlich wissen.
ADHS ist überall. Im Klassenzimmer, am Familientisch, in Medien, im Besprechungszimmer. Von einer «Modeerscheinung» ist die Rede, von einer «Trenddiagnose», einem regelrechten «Boom» um Medikamente. Gleichzeitig berichten Betroffene, wie entlastend es sein kann, endlich eine Erklärung für das diffuse Gefühl der Überforderung zu haben, für das ständige Scheitern an Dingen, die für andere selbstverständlich seien. ADHS polarisiert, ist begleitet von Ängsten und Misstrauen. Und es trifft in einer Leistungsgesellschaft einen sensiblen Nerv: die Frage nach dem Kindeswohl.
Wer sich den Fragen rund um ADHS annähert, merkt jedoch schnell, dass die Antworten nicht mehr, sondern weniger werden. Verlässliche Daten zur psychischen Störung sind spärlich. Das prägt auch in Schaffhausen, wo ADHS längst zum regionalen Thema geworden ist. Aber wie genau? Und warum?
Jörg, 36
«Ich war schon von klein auf ein Einzelgänger. Die grossen Schulklassen, in denen ich war, machten mir Probleme, erst in der Breite, dann im Steig, später auch im Emmersberg. Ich war ein introvertiertes Kind – und nur gut in dem, was mich interessiert hat. Ich wusste immer, dass etwas nicht stimmt, dass ich anders bin.
Ich war impulsiv und ging schnell an die Decke. Irgendwann kam ich mit dem Gesetz in Konflikt, sogar ein Heim stand im Raum. Immer, wenn etwas mit mir war, schob man das auf meinen Vater. Er war gestorben, als ich gerade zehn Jahre alt war. Niemand kam auf die Idee, dass etwas anderes der Grund sein könnte. Es hiess einfach, ich sei ein Zappelphilipp, das würde sich rauswachsen mit der Zeit.
Eher über Androhungen als sonst etwas habe ich eine Lehrstelle als Betriebspraktiker Hausdienst gefunden. Wirklich nur, weil ich musste. Mit 19 schloss ich sie ab. Da hatte ich schon den Fahrausweis und habe gemerkt, wie sehr ich beim Autofahren herunterkomme. So sehr, dass ich die Lehre zum Lastwagenführer angehängt habe. Als mir angeboten wurde, in die Disposition zu wechseln, habe ich die Chance wahrgenommen – obwohl ich nicht der Typ für viele Wechsel bin und ich eine klare Struktur brauche. Am neuen Arbeitsplatz kamen wieder die Probleme. Ich war mit der ganzen Konzentration, die ich dort brauchte, und vom Druck meines Chefs so überlastet, dass ich schon nach einer Stunde Arbeit massive Kopfschmerzen hatte.
Ein guter Freund von mir schilderte dieselben Probleme. Er hat sich mit 20 abklären lassen. Einmal gab er mir eine seiner Tabletten zum Ausprobieren. Die Sonne schien aus meinem Kopf! Es war so schön. Ich dachte: So fühlen sich andere immer, einfach so? Ich sage Ihnen: Ein solches Gespräch, wie ich es jetzt mit Ihnen führe, wäre damals nicht möglich gewesen. Für neurotypische Menschen ist nicht vorstellbar, was ADHS mit sich bringt. ADHS fühlt sich an, als wäre ich ein Löwe im Zoo, der in Gefangenschaft aufgewachsen ist. Er weiss nichts über das Leben ausserhalb des Käfigs, in dem er frei wäre zu tun, was er will.
Nach dieser Erfahrung – und aus Leidensdruck bei der Arbeit – habe ich das Ganze meinem Hausarzt erzählt und anschliessend begonnen, herumzutelefonieren. In Schaffhausen sagten mir alle: Da könne ich lange warten. Eine Psychologin in Feuerthalen nannte gar eine Wartefrist von bis zu 1,5 Jahren. Darum habe ich es in Zürich probiert. Dort hat man mich an eine spezialisierte Klinik überwiesen. Innert wenigen Wochen hatte ich einen Termin und die Erfahrung war super. Die Abklärung ergab sinngemäss, ich sei ein Bilderbuchbeispiel von ADHS. Seither verschreibt mir mein Hausarzt alle drei Monate Concerta, also Methylphenidat. Ich bin froh, endlich Ruhe zu haben.»
*
Was meint man, wenn man von einer Zunahme von ADHS spricht?
ADHS gilt als Entwicklungsstörung. Betroffene – mehrheitlich Kinder – fallen als impulsiv und getrieben auf, sie können nicht ruhig sitzen, sind unaufmerksam und vergesslich, kurz: Sie stören. Das macht ADHS anschlussfähig für Systemkritiker:innen, die das Kindeswohl innerhalb der schulischen Strukturen gefährdet sehen: Nicht mein Kind ist krank, sondern die Schule, die überforderten Lehrpersonen, der Lehrplan 21, und so weiter.
Medizinischen Schätzungen zufolge haben rund 5 Prozent aller Kinder ADHS, und zwar stabil über die Jahre hinweg. Das ist ungefähr ein Kind pro Schulklasse – oder, im ganzen Kanton Schaffhausen, rund 450 Kinder und Jugendliche, die derzeit die Volksschule besuchen. Hinzu kommen zwischen 2,5 und rund 5 Prozent aller Erwachsenen. Allerdings zeigt kein Register auf, wie oft die Diagnose in der Schweiz gestellt wird – und wenn, dann wäre auch diese Zahl trügerisch. Denn die Symptome von ADHS lassen sich nicht scharf von dem abgrenzen, was als normal gilt; der Punkt, an dem «gesund» in «krankhaft» übergeht und eine Diagnose möglich ist, macht sich am Leidensdruck der Betroffenen fest. Die Forschung versteht ADHS mehr und mehr als Spektrum, dazu am Ende dieses Textes mehr.
Auch sonst sind Annäherungsversuche über Zahlen rund um ADHS schwierig, weil sie immer nur Teilaspekte des Phänomens aufgreifen. Das zeigten jüngst Zahlen des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan). Das Obsan erfasst jedes Jahr im nationalen Versorgungsatlas – nebst Knieoperationen, Blasenkathetern oder Mammographien – auch die Abgabe von ADHS-Medikamenten in den Kantonen. Der Anstieg verschriebener Medikamente ist hier eindeutig: Noch 2015 wurden im Kanton Schaffhausen rund 2,6 Tagesdosen pro 1000 Einwohner:innen und Tag verordnet. 2020 waren es bereits 3,8 solcher Dosen, und im Jahr 2023 schon deren 5,4. Aktuellere Zahlen sind noch nicht verfügbar.
Geschlechterunterschiede sind dabei unverkennbar. Buben zwischen 11 und 15 Jahren erhalten 2023 unter allen Kindern am meisten ADHS-Medikamente (gleichaltrige Mädchen erhalten nur rund die Hälfte davon) – nur erwachsene Männer zwischen 36 und 40 sowie zwischen 46 und 50 liegen höher. Mit ein Grund: Bei Mädchen wird ADHS öfters nicht erkannt. Sie zeigen eher den unaufmerksamen ADHS-Typ, ihre Symptome sind unauffälliger. Zudem galt ADHS lang als Bubenkrankheit.
Zugenommen hat also nicht die Verbreitung von ADHS als Störung an sich, aber die Anzahl der verschriebenen Medikamente und ergo der Abklärungen, wobei nicht jede Abklärung zu Medikamenten führen muss.
«Für neurotypische Menschen ist nicht vorstellbar, was ADHS
Jörg
mit sich bringt.»
Im Kanton Schaffhausen sind der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst (KJPD) und die Abteilung Schulische Abklärung und Beratung (SAB) die wichtigsten Anlaufstellen zum Thema ADHS. Sie haben in den vergangenen Jahren eine Zunahme an Anfragen und Abklärungen verzeichnet – und beobachten diese mit Sorge. Die SAB hat vergangenes Jahr sogar ein eigenes Angebot aufgebaut, um das Gesamtsystem zu entlasten, insbesondere Schüler:innen. Seither kann die SAB Verdachtsdiagnosen stellen, so dass allfällige Nachteilsausgleiche und Sonderschulmassnahmen zeitnah umgesetzt werden können. Für die war bis anhin eine psychiatrische Diagnose notwendig.
Warum die Zahl der Abklärungen, Diagnosen und Medikationen steigt, dazu gebe es aber bis heute keine eindeutige wissenschaftliche Erklärung, sagt Jan-Christoph Schaefer. Er ist seit 2016 Chefarzt des KJPD und beobachtet schon seit der Coronapandemie einen – globalen – Anstieg der psychischen Belastung bei Kindern und insbesondere Jugendlichen. «Ich könnte mir vorstellen, dass die damit einhergehende gesellschaftliche Verunsicherung sich auch bei diesem spezifischen Thema ADHS zeigt.» Gleichzeitig betont Schaefer aber: «Als Modeerscheinung kann man ADHS nicht bezeichnen. Die ersten klinischen Beschreibungen stammen bereits aus dem 18. Jahrhundert.» Wenn man die Zunahme der Aufmerksamkeit auf das Thema in Medien und Gesellschaft beobachte, könne man indes von einem Trend sprechen.
Schaffhausen ist in diesem Trend allerdings anders unterwegs – und zwar in sehr deutlichem Ausmass. Das schlägt sich zumindest in den Medikamenten nieder. Bei Erwachsenen liegt Schaffhausen mit 5,4 Tagesdosen auf 1000 Personen und Tag immer sehr nah am Schweizer Durchschnitt von 5,8. Bei Kindern und Jugendlichen ist der Unterschied hingegen frappant: Liegt der Schweizer Schnitt bei 10,3 Dosen, liegt er in Schaffhausen bei gerade 5,5 Dosen. Nur drei Kantone – der Tessin, Appenzell Innerrhoden und Glarus – liegen noch tiefer.
Und auch hier weiss man nicht, weshalb.
*
ADHS-Medikamente sind ein Marker für eine schweizweite Tatsache: Die psychiatrische Versorgung unterscheidet sich in den verschiedenen Regionen des Landes enorm. «Erklärbar sind diese Unterschiede aktuell aber nicht.» Das sagt Urs Hepp, ehemaliger ärztlicher Direktor der Integrierten Psychiatrie Winterthur und Co-Autor einer Obsan-Studie von 2024, welche die verschiedenen psychiatrischen Angebotsstrukturen in den Regionen untersuchte. «Wir haben nur Erklärungsversuche. Ein Faktor könnten kulturelle Unterschiede in den Regionen sein: der Umstand also, dass Kinder- oder auch Erwachsenenpsychiater:innen in einer Region stärker aufs Thema sensibilisiert oder spezialisiert sind als in anderen.»
In einem kleinen Kanton beeinflusst die Haltung individueller Ärzte die Region ungleich mehr. Eine Antwort auf die Frage nach dem Warum dürfte also beim KJPD liegen. In der psychiatrischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen im Kanton Schaffhausen hat er quasi Monopolstellung; nur zwei weitere Psychiater:innen sowie einige wenige Kinder- und Jugendpsycholog:innen im ganzen Kanton bieten rund um ADHS Unterstützung an. Das heisst, Vorgehen und Haltung des KJPD setzen sich hier durch.
Jan-Christoph Schaefer erklärte in einem Interview mit den Schaffhauser Nachrichten Ende Juni, wie der KJPD beim Thema ADHS vorgeht. «Wir stellen die Indikation für eine Medikation grundsätzlich sehr sorgfältig und orientieren uns am individuellen Bedarf», sagt er darin unter anderem, oder auch: «Die Behandlung folgt nicht immer demselben Ablauf, in der Tendenz erwägen wir eine Medikation jedoch eher bei ausgeprägten Symptomen.» Der Chefarzt drückt sich vorsichtig aus – und vorzugsweise schriftlich. Er weiss um die aufgeladene Stimmung und die häufigen Fehlannahmen rund um ADHS. Das Interview macht denn auch zwei Dinge deutlich: einerseits, dass Medikamente nur ein Teilaspekt der Behandlung von ADHS sind – aber einer, der medial übermässig viel Aufmerksamkeit erhält.
Andererseits löst das Interview dann tatsächlich auch negative Reaktionen aus: In sozialen Medien häufen sich kurzzeitig wütende Kommentare Betroffener, die in Schaffhausen zu wenig oder zu spät Hilfe erhalten und sie deshalb in Zürich gesucht haben.
Von langen Wartezeiten ist am KJPD trotz hohem Interesse am Thema ADHS zur Zeit keine Rede: Gemäss Chefarzt Schaefer finde eine erste ausführliche Beratung von anmeldenden Eltern oder Jugendlichen in der Regel noch am gleichen Tag statt. Nach dieser Intervention seien Wartezeiten möglich, diese lägen aber in 80 Prozent der Fälle unter sieben Wochen. Bei der SAB variieren die Wartezeiten saisonal: Im Winter stehen vermehrt Sonderschulabklärungen an, sodass ADHS-Abklärungen gerade bei leichten Symptomen eher hintenanstehen.
Zum interkantonalen Vergleich und zu möglichen Patientenströmen in den Nachbarkanton wollen weder Jan-Christoph Schaefer noch Mathias Oechslin Stellung beziehen.
«Die Diagnose schwebt wie ein Damoklesschwert über allem.»
Hannah
Der Forscher Urs Hepp, der regionale Unterschiede in der Psychiatrie untersucht, sagt es deutlicher: «Statistische Ausreisser können Hinweise auf eine Über- oder Unterversorgung geben.» Zwar sei es nicht seriös, allein von der tiefen Abgabe von ADHS-Medikamenten automatisch auf eine medizinische Unterversorgung im Kanton zu schliessen. «Ein Teil der tiefen Zahlen lässt sich wohl durch die Zurückhaltung des KJPD erklären. Und eine sorgfältige Arbeitsweise ist per se ja wünschenswert», sagt Hepp. «Im Wissen darum, dass die Kinderpsychiatrie in Schaffhausen generell schwach aufgestellt ist und somit weniger Diagnosen und Behandlungen gemacht werden, ist aber auch eine Unterversorgung möglich. Man müsste stärker in die Tiefe gehen, um das zu verstehen.»
Hannah*, 38
«Oskar war von Anfang an ein sehr aktives und temperamentvolles Kind. Mit dreieinhalb Jahren hatte er Wutausbrüche, die eine halbe Stunde oder länger dauern konnten. Im Kindergarten ging noch alles gut – in diesem Alter wird von den Kindern auch noch nicht so viel verlangt.
Etwa einen Monat nach Oskars Einschulung bat uns seine Klassenlehrperson um ein Gespräch. Sie meinte, Oskar habe mit der Konzentration und Aufmerksamkeit Mühe, und fragte uns, ob wir einen Seh- und Hörtest gemacht hätten. Wir wussten, dass da alles in Ordnung war. Darum lag der Verdacht bald bei ADHS. Das kam nicht unerwartet. Schon in der Kita hiess es, unser Kind sei manchmal wie unter einer Glasglocke.
In der Schule mag Oskar sich zusammenreissen, zuhause verstärkten sich die Probleme. Hier lässt er den emotionalen Ballast raus. Besonders die körperlichen Attacken sind für uns sehr herausfordernd. Ich merke, wie schwierig es ist, jeden Tag Geduld mit ihm zu haben. Uns war klar, dass er mehr Unterstützung und Führung benötigt; darum habe ich mein Arbeitspensum reduziert. Wir wussten dennoch nicht, wie weiter, hatten Angst, dass Oskar in der Schule den Anschluss verliert. Ich kenne heute diverse Eltern, die sagen: Hätten wir uns doch früher darum gekümmert.
Mein Mann und ich wandten uns im Herbst vergangenen Jahres an den KJPD. Wir wurden schnell aufgenommen, das hat uns positiv überrascht. Schon nach einer Woche hatten wir einen ersten Termin – noch ohne Oskar. Eine ADHS-Diagnose ist aus verschiedenen Aspekten zusammengesetzt: aus Berichten der Eltern und der Schule sowie aus Beobachtungen und Tests des Kindes. Darum machte das Vorgehen zunächst Sinn. Uns wurde zudem immer wieder gesagt: Was Oskar fehle, sei erst einmal nicht relevant. Es gehe zuerst darum, die Situation zu verbessern.
Seit November hatten wir sieben Gespräche mit dem KJPD, wir haben mehr Verständnis für das Verhalten unseres Kindes bekommen. Aber wenn du Bauchschmerzen hast, wird irgendwann relevant, ob diese Schmerzen von einer Verstimmung, von einem Magengeschwür oder einer Schwangerschaft herkommen. Darum ist für mich je länger je störender, nicht beim Namen nennen zu können, was Oskar hat. Es wäre eine Entlastung, endlich ein Wort für sein Verhalten zu haben. Ob Oskar ein Medikament benötigt, wäre eine gesonderte Frage im Anschluss daran.
Da aber spüre ich Widerstand beim KJPD – niederschwellig, in Nuancen. Etwa darin, dass im Erstgespräch thematisiert wurde, dass ADHS als eine ‹Modeerscheinung› gelte. An dieser Sitzung wurde uns von der Psychologin ein Post-It mit dem Wort ‹ADHS› übergeben und sie fragte uns, ob uns das jetzt helfen würde. Wie gern hätte ich gesagt: Ja, würde es!
Ich verstehe die Zurückhaltung des KJPD zwar zu einem gewissen Punkt. Es spielen sehr viele Faktoren mit. Trotzdem führte die starke Zurückhaltung dazu, dass Oskar erst diesen Sommer einen Intelligenztest machen konnte. Das ist nervenaufreibend. Eine befreundete Familie konnte nicht so lange warten, sie war in einer Notsituation. Sie ging in den Kanton Zürich und wurde dort sofort prioritär behandelt.
Nach allem, was ich heute über das Thema weiss, bin ich zu 90 Prozent sicher, dass Oskar ADHS hat. Das schwebt wie ein Damoklesschwert über allem: Menschen mit ADHS haben nebst Selbstwertproblemen auch ein erhöhtes Risiko für Depressionen, eine Drogenabhängigkeit oder Suizidalität. Das wünsche ich keinem. Ich bin zuständig dafür, Oskar sicher in die Welt zu begleiten. Ich will ihm helfen, wie ich kann.»

*
Der starke Fokus auf Kinder in der Debatte hat einen Nebeneffekt: Dass auch Erwachsene von ADHS betroffen sein können, geht in der Tendenz unter. Noch bis in die 1990er-Jahre ging die Forschung davon aus, dass ADHS sich auswachse, dass also die Symptome im Erwachsenenalter verschwinden. Heute geht man aber davon aus, dass sie bei 40 bis 60 Prozent der Erwachsenen relevant bleiben und Arbeit, Alltag und Beziehungsleben beeinflussen.
An Hilfe zu kommen, ist jedoch schwierig. Wer eine Abklärung oder Diagnose anpeilt, muss mit teils langen Wartezeiten rechnen – nicht nur bei im Kanton niedergelassenen Fachpersonen, sondern auch in Zürich. Wie viele tatsächlich für eine ADHS-Abklärung in den Nachbarkanton reisen, ist statistisch nicht erwiesen. Das Obsan erfasst nur generelle Patient:innenströme in der Psychiatrie und Psychotherapie. Demzufolge reisen 24 Prozent aller Patient:innen nach Zürich – umgekehrt macht es niemand. Bei Kindern sind es übrigens nur 15 Prozent – obwohl deren Versorgungsgrad in der Psychiatrie mit 91 Prozent tiefer liegt als bei Erwachsenen mit 95 Prozent.
Eine Umfrage bei verschiedenen Kliniken in Zürich ergibt ein gemischtes Bild: Die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich und mehrere andere Fachstellen erfassen keine Wohnortdaten ihrer Klient:innen. Eine grössere Privatklinik in Zürich nennt eine tiefe zweistellige Zahl an Schaffhauser:innen in Behandlung. Und das Kantonsspital Winterthur schreibt, dass 2024 rund 130 Kinder und Jugendliche aus dem Kanton Schaffhausen abgeklärt und behandelt wurden.
Rund um die Versorgung bei ADHS bleibt also erstaunlich viel eine Black Box – gemessen daran, wie gross die Debatte darüber ist.
Ursina, 32
«ADHS bezeichnet ein Spektrum, Symptome zeigen sich bei Menschen unterschiedlich stark. Ich glaube, die Grenzen zum ‹normalen› Ringen mit den krassen Leistungsansprüchen unserer Zeit ist schmal. Die meisten meiner Mitstudierenden kämpften auch mit Prokrastination, also dem Aufschieben von Arbeit. Bei mir aber war dieses Problem frappant. Wenn um Mitternacht Abgabeschluss einer Arbeit war, gab ich sie nicht vor 23.59 Uhr ab – meist habe ich sogar noch am selben Abend erst angefangen, sie zu schreiben. Ohne Druck brachte ich nichts zustande.
Dass ich ADHS habe, wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Bei mir wurden Depressionen diagnostiziert, als ich ungefähr 16 Jahre alt war. Das stand im Vordergrund der Behandlungen. Die Komorbidität mit ADHS ist aber gross, und die Symptome überschnitten sich: ein tiefes Selbstwertgefühl, ständige Selbstzweifel, ein dauerndes Grundrauschen im Kopf. Ich kannte nichts anderes.
Manches konnte ich kompensieren. So machte ich wenigstens den Eindruck, dass ich mein Leben im Griff hatte: keine Schulden, kein Substanzenmissbrauch, keine Kriminalität. Aber ich stand ständig am Rand eines Zusammenbruchs. Wurde dann die Depression behandelt, fühlte sich das so an, als würde man an den falschen Schrauben drehen.
Schliesslich führte mich eine Kombination aus dem persönlichen Umfeld und sozialen Medien zum Verdacht, dass ich von ADHS betroffen sein könnte. Ich erkannte mich in den Alltagsbeschreibungen anderer Betroffener wieder. Ich habe zwar zum Social-Media-Algorithmus sehr gemischte Gefühle. Es werden mir oft Inhalte vorgeschlagen, die mir das Gefühl geben, mein Scheitern habe primär mit meinem Hirn zu tun und nicht auch mit starren gesellschaftlichen Erwartungen. Gleichzeitig macht mich wütend, dass mein Weg zur Diagnose erst so zustande kam – statt über die psychologische Expertise in der Schweizer Gesundheitsversorgung.
Ich lebte zu diesem Zeitpunkt in Zürich und hatte dort eine psychologische Betreuung. Aber mein Hausarzt war in Schaffhausen. Nach Rücksprache mit meiner Psychologin habe ich dort im Rahmen einer Blutentnahme einmal angetönt, dass ich eine ADHS-Abklärung starten werde. Die Reaktion meines Hausarztes war: «Da müssen Sie aufpassen!» Er habe schon Patientinnen gesehen, die nach solchen Untersuchungen regelrecht verwirrt gewesen seien und irgendwelche Pillen schlucken würden. Das Misstrauen, das er aussprach, hat mich enorm frustriert. Ich hatte zum ersten Mal in 31 Jahren das Gefühl, dass es diagnostisch bei mir in eine Richtung gehen könnte, die mir bisher unerklärbare Dinge erklären könnte. Und dann das. Ich war nach diesem Gespräch nie wieder bei ihm.
Die Diagnostik habe ich vergangenen Oktober in Zürich gemacht. Die Diagnose ADHS folgte kurze Zeit später. Ich war erleichtert, eine Antwort zu haben. Aber ich merkte auch, dass meine Probleme damit nicht gelöst waren. Mit der Diagnose kamen neue Verunsicherungen: Was war ich, was war ADHS? Würde sich meine Persönlichkeit verändern, wenn ich ADHS-Medikamente nehme? Auch ist mit der Diagnose allein noch keine Therapie gemacht; das alles zu organisieren, hat mich in ein tiefes Loch geworfen. Und trotzdem: Ich bin froh, dass ich heute mehr über mich und meine Biografie weiss.»
*
Vor zwölf Jahren fand an der Universität Zürich zum ersten Mal eine Tagung zum Thema ADHS statt. Man dachte damals, das Thema würde wieder an Bedeutung verlieren. Doch am vergangenen Donnerstag kamen erneut Kinderärzt:innen, Therapeuten und Expert:innen zusammen, um über ADHS zu diskutieren. Auch Jan-Christoph Schaefer und Mathias Oechslin aus Schaffhausen waren dabei.
Heute betrachtet die Forschung ADHS differenzierter: nicht nur als Spektrum, sondern auch als Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen. ADHS wird zunehmend sozial interpretiert, als Ausdruck von Bildungsexpansion und Akademisierung beispielsweise, von veränderten Familienmodellen oder als Ausdruck einer perfektionistischen Gesellschaft. Angesichts dieser Komplexität wäre vielmehr zu fragen, welche Ansätze nicht nur einzelne ADHS-Betroffene unterstützen – sondern wie Strukturen, an denen Menschen zunehmend zu scheitern drohen, verändert werden können.
* Namen von der Redaktion geändert
Wir schenken Dir diesen Artikel. Aber Journalismus kostet.
Hier geht es zum Probe-Abo: drei Monate lang jede Woche eine AZ für nur 48 Franken.