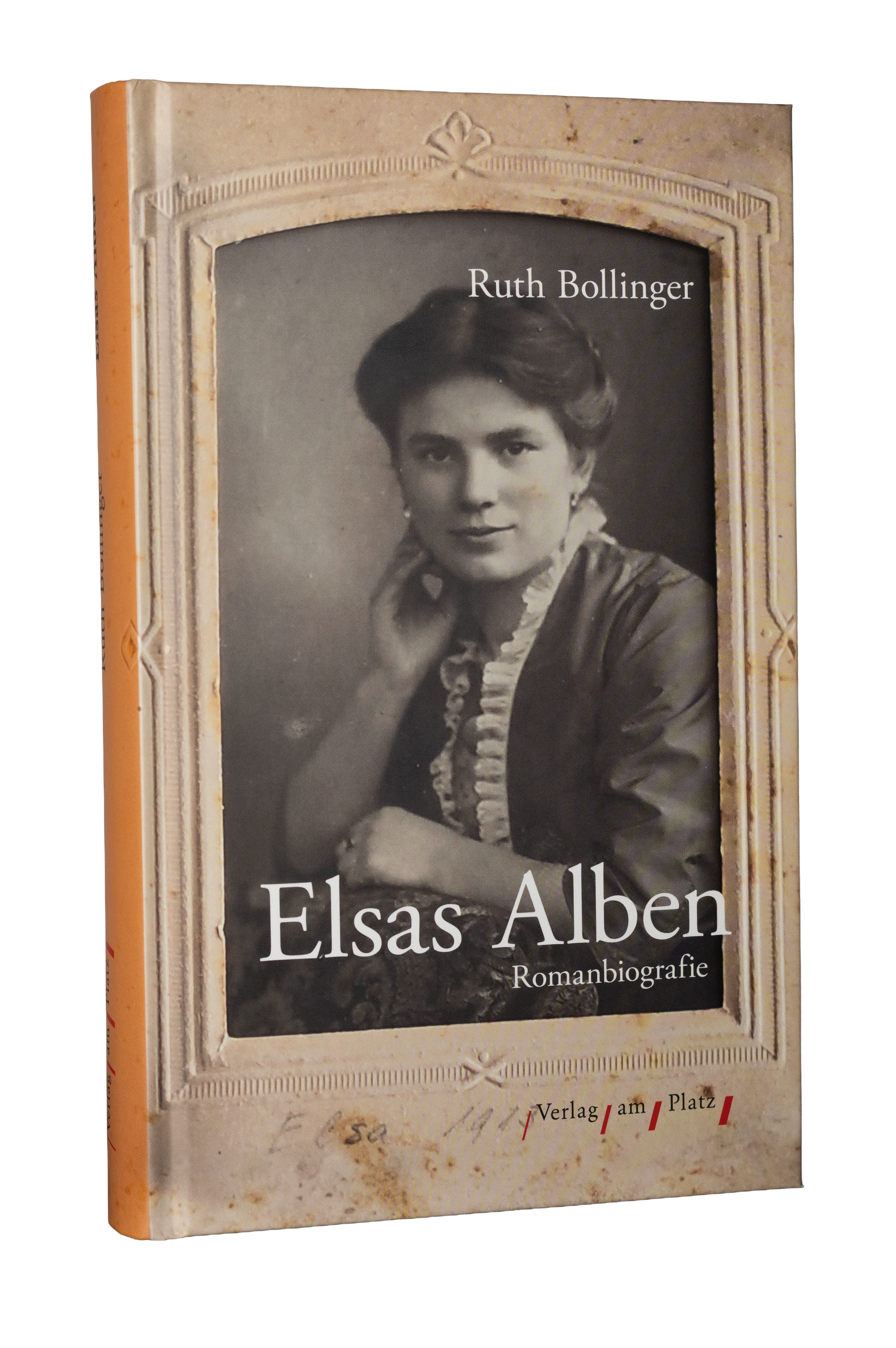Rosmarie Widmer Gysel war von 2005 bis 2018 Finanzdirektorin des Kantons Schaffhausen. Foto: Robin Kohler
Die Tatsache, dass wir heute nicht wirklich weiter sind in Sachen Gleichstellung, belastet mich manchmal. Ich habe sogar das Gefühl, das gewisse Rollenbilder mehr in Stein gemeisselt sind als früher. Das ist doch völlig widersinnig. Es sollte doch umgekehrt sein, nicht mehr wie damals in den Siebzigern, als mein Vater mir verboten hatte, die Matura zu machen. Ich lernte schliesslich Gärtner, ebenfalls zum hellen Entsetzen meines Vaters, aber ich war mittlerweile 19 und konnte selbst entscheiden.
Mit 21 Jahren ging ich ins Militär, der Grund war tatsächlich die Diskussion um das Frauenstimmrecht. Mein Vater war vehement dagegen (meine Mutter absolut dafür), seine Haltung dazu war: «Beweist, was ihr draufhabt, bevor ihr Forderungen stellt.» Eine Aussage, die mich seither immer begleitet hat. Ich habe mich damals also vor allem aus Trotz ausheben lassen. Nach der Grundausbildung machte ich weiter, bis zum Rang eines Obersts. In meinem ersten WK als Zugführer leitete ich einen Zug Gebirgsfüsiliere: alles Männer, alle zwei Köpfe grösser als ich, alle hatten noch nie eine Frau als Chef gesehen. Aber es ging gut, und das zeigte mir, dass es möglich ist, wenn man will. Ich hatte mein ganzes Berufsleben und auch in meiner Politkarriere vor allem mit Männern zu tun. Trotzdem gab es nur ganz wenige Momente, wo ich Ungleichheit zu spüren bekam. Vielleicht bin ich auch einfach mit einer gewissen Selbstverständlichkeit an die Sache herangegangen, ich brauchte gar nie zu diskutieren.
Ich denke, heute ist viel Unsicherheit vorhanden in der Diskussion, wie ein Mann oder eine Frau sein sollte. Konzentrieren wir uns auf Dinge, die gar nicht so wichtig wären? Jeder sollte doch so sein dürfen, wie er ist. Und wenn dir einer zu nah kommt, wehrst du dich. Natürlich gibt es Ungerechtigkeiten und Ungleichheit, trotzdem würde ich nie an einen Frauenstreik gehen. Ich kann nur immer wieder demonstrieren, dass man erreichen kann, was man will. Ich erfülle meine Pflichten, nehme mir aber auch alle Rechte aus, denn ich bin überzeugt davon, dass man sich selbst und seine Rechte nicht hinterfragen darf. Es braucht mehr Frauen, die ihre Position als selbstverständlich wahrnehmen.
*

Ich erlebe es in meinem Berufsalltag: Die Ansicht, dass Angehörigenpflege nicht die Aufgabe der Söhne oder Enkel, sondern der Töchter sei, ist immer noch sehr verbreitet. Im Gesundheitswesen braucht es mehr Wertschätzung, und ich rede nicht von Applaus. Der Respekt für Care-Arbeit und den Pflegeberuf an sich fehlt auch sonst. Oft auch, weil die wenigsten Patient:innen hinter die Kulissen sehen. Es ist zeitweise frustrierend, denn vieles, was wir in der Pflege leisten, ist unbezahlte Care-Arbeit. Weil wir nicht «messbare» Leistungen gar nicht abrechnen können. Ich muss jedes Mal prüfen, ob in der vorab festgelegten Pflegezeit auch noch Zeit für ein Gespräch bleibt. Es sollte andersherum sein: Gerade fürs Zuhören und Reden bleibt oft zu wenig Zeit, was aber wichtig wäre, weil die Leute auch einfach mal etwas loswerden müssen. Eigentlich wäre dies Aufgabe der sozialpsychologischen beziehungsweise Betreuungsbranche. Es gibt aber schlicht keine Angebote für Menschen, die kein soziales Umfeld mehr haben.
Oft verstehen Patient:innen nicht, warum man nicht sofort springt. Dann wiederum gibt es viele, die sich sehr bewusst sind, was wir im Pflegeberuf leisten. Das sind meistens Frauen, die wissen, was es heisst, Care-Arbeit zu leisten, und zwar altersunabhängig. Gerade ältere Frauen sagen oft, sie seien sogar froh, eine Auszeit im Spital zu haben, weil zu Hause der Mann und der Haushalt warten. Haus- und Care-Arbeit ist Frauensache – die Stigmatisierung des Themas ist immer noch hoch, es beginnt schon bei berufstätigen Müttern, die schief angeschaut werden, wenn sie stillen.
Die jüngere Generation ist sich des Problems bewusster, auch weil der Zugang zu Informationen einfacher ist. Allerdings führt dies oft zu extremen Ansichten, weil die eigene Bubble mit dem Algorithmus geformt wird. Es fehlt das Bewusstsein, dass das Ziel eben noch nicht erreicht ist. Es sollte viel selbstverständlicher darüber gesprochen werden. Gleichstellung muss Lehrstoff werden, am besten schon im Kindergarten, das ist wichtiger denn je.
Für viele Berufskolleg:innen und auch für mich ist unsere Arbeit dennoch Berufung, ich glaube wirklich, dass ich einen aktiven Teil zu einer besseren Welt beitragen kann. Das motiviert mich, weiterzumachen.
*

«Die Pille für den Mann kommt in fünf Jahren» – das ist ein Running Gag in der Medizin. Bisherige Versuche, die Pille an den Mann zu bringen, sind meistens an den Nebenwirkungen gescheitert. Dazu gehörten Stimmungsschwankungen, Haarausfall und Gewichtszunahme; auch die Angst vor der Unfruchtbarkeit oder Inkompatibilität mit Alkohol waren Hindernisse. Bei Frauen waren solche Nebenwirkungen der Pille lang akzeptierter. Ich sehe zwei Gründe dafür. Erstens müssen sich Menschen mit Uterus eher mit den Konsequenzen einer Schwangerschaft oder eines Schwangerschaftsabbruchs beschäftigen. Und dann ist da auch der Gedanke mancher Männer: Das ist nicht unser Problem, darum müssen wir uns nicht kümmern.
Ich merke aber, dass sich das allmählich ändert. Bei vielen Frauen macht sich eine Hormonmüdigkeit breit. Gleichzeitig fragen sich mehr Männer, wie sie Verantwortung übernehmen können.
Bei abgeschlossener Familienplanung ist die Unterbindung des Mannes, die Vasektomie, eine sehr gute Option. Auch da gibt es viele Vorurteile – etwa, ob man dann noch «ein richtiger Mann» ist. Da versuche ich genau zu erklären, was der Eingriff bedeutet und was nicht.
Ist die Familienplanung nicht abgeschlossen, ist das Kondom die populärste Methode, die zeitgleich auch vor sexuell übertragbaren Erkrankungen schützt. Neu – und gleichzeitig sehr alt – sind thermische Methoden, bei denen die Hoden erwärmt werden. Hoden hängen ja aus einem Grund etwas ausserhalb des Körpers: Sind sie der Körpertemperatur von 37 Grad ausgesetzt, wird die Spermienproduktion gehemmt. Früher haben Menschen darum ihre Hoden heissem Sand ausgesetzt oder in warmem Wasser gebadet. Die Pharmaindustrie hat diese Methode vernachlässigt, wohl weil kaum Gewinn damit gemacht werden kann.
In Frankreich hat eine Gruppe Männer begonnen, mit einem Ring thermisch zu verhüten. Die Idee ist, den Ring über den Penis und Hodensack zu stülpen und die Hoden damit etwas anzuheben. Als Medizinalprodukt darf dieser Ring noch nicht verkauft werden – dafür fehlt die Studienlage. Die Medizin ist enorm vorsichtig in der Zulassung neuer Produkte: Sie müssen sicher und reversibel sein und dürfen Nutzer:innen nicht schaden. Darum verkaufen die französischen Aktivisten diesen Ring jetzt als Talisman und sammeln aktuell Geld für die Zulassung.
*

Einerseits sind Orte der Kultur an sich politisch, weil sie für etwas einstehen, das in einem kapitalistischen System nicht per se legitimiert ist. Ausstellungen und Museen müssen nicht zwingend eine bestimmte Politik vertreten, aber sie sollen Orte kreieren, die zum Nachdenken anregen. Gleichzeitig will ein Museum ein Ort sein, an dem ganz viele verschiedene Menschen zusammenkommen, nicht nur solche mit einer vorherrschenden Meinung.
Trotzdem sind Feminismus, Kunst und Kultur eng miteinander verbunden: Bereits in den 1980er-Jahren wollte eine Aktion der Kunstaktivistinnen «Guerilla Girls» aufzeigen, wie viele Frauen in Museen eine Bühne bekommen. Das Ergebnis war ernüchternd: Im Metropolitan Museum of Art stammten nur knapp fünf Prozent aller Kunstwerke von Frauen, wohingegen 85 Prozent der Aktdarstellungen Frauen abbildeten. Diese Zahlen haben sich auch heute nicht stark verändert, das frustriert. Dabei finde ich unbedingt: Wir müssen uns fragen, wen wir wie adressieren, mit wem wir zusammenarbeiten. Feminismus ist daher nur ein anderes Wort für Gleichberechtigung in der Gesellschaft – und ich denke, eben diese sollte ein Museum spiegeln. Ich bin keine Aktivistin und keine Missionarin, aber in meiner Position habe ich eine Vorbildfunktion. Ich kann Aspekte, die mir wichtig sind, aktiv einbringen – zum Beispiel die Verwendung von inklusiver Sprache.
Auch vermeintlich kleine Sachen sind wichtig, um ein Umdenken zu provozieren. Und dieses Umdenken braucht es immer noch, das erlebt wohl jede Frau. Das Aussehen wird kommentiert, das Outfit, in meinem Fall ist es meine Kurzhaarfrisur. Das machen Männer – und auch Frauen. Es kam auch in meinem Arbeitsalltag vor, dass manche nach Teamsitzungen sagten: Wenn eine Frau redet, gibt es immer mindestens drei Männer, die gerade etwas anderes besprechen und nicht mehr zuhören.
Das ist auch ein Grund, weshalb ich mein Hochdeutsch bewusst beibehalten habe, anstatt auf Schweizerdeutsch umzusteigen. Ich habe mittlerweile gemerkt: Die Sprache hilft mir dabei, eine Grundautorität aufzubauen, ernster genommen zu werden. Ich verschaffe mir Gehör.
*

Die Schäferei soll für alle ein möglichst sicherer Ort sein. Das merken die Leute, wenn sie hier hereinkommen, sofort. Wir hängen natürlich kein Schild über die Tür, das sagt: «Ladies, hier macht euch keiner an.» Aber man merkt zum Einen an den Klebern an den Wänden, dass es hier politisch eher in eine antifaschistische Richtung geht. Und unser Klientel tickt auch so, dass man hier aufeinander Acht gibt. Das spricht sich herum. In 17 Jahren Schäferei habe ich zwei Mal Kerle wegen ihres Verhaltens Frauen gegenüber rausgestellt: Einer hat sich auf eine Art geäussert, die mit unserem Weltbild nicht klarging. Ein anderer hat nicht verstanden, dass Nein Nein heisst. Der Herr wurde dann von mir und einem Kollegen herauskomplimentiert. Das war auch für ihn besser.
Ich kenne relativ viele Menschen, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind. Es ist ein garstiges Thema. Die Vergewaltigung beim Ebnatkreisel letztes Jahr und die Geschichte von Fabienne W. haben mich ziemlich erschüttert. Ich habe mich danach bei den SP-Frauen erkundet, was ich zu einem sichereren Ausgangsleben beitragen könnte. Sei es ein Sammeltopf für Geldspenden, damit Flyer finanziert werden oder Aufkleber mit QR-Codes, die Hilfsangebote aufzeigen. Keine grosse Sache also, aber es wäre ein Beitrag.
Im Ausgang spielt natürlich Alkohol eine Rolle. Der kann schon mal die eine oder andere Gehirnwindung verschlacken. Darauf sollte in der Gastro mehr Aufmerksamkeit liegen. Ich meine insbesondere Grossveranstaltungen wie das Lindlifest oder früher im Orient – Orte, an denen auch mal unkontrolliert reingeschüttet wird. Das mag ich nicht. Ich habe auch schon jemandem am Stammtisch gesagt: Du kriegst hier nichts mehr heut Nacht. Und klar kann das auch schwierig werden und verbal ausarten. Wichtig ist es trotzdem, und ich hab da als Wirt auch mehr zu sagen als vielleicht andere Gäste.
Ansonsten wünsche ich mir, dass der eine oder andere Mann einmal die Augen aufmacht und sieht, was in der Gleichstellungspolitik falsch läuft – und dass es sich nicht um Fantasiegebilde irgendwelcher Feministinnen handelt. Gleichstellung ist nicht einfach «Frauensache». Wenn man in dieser Gesellschaft den Status Quo verändern will, geht das nicht geschlechtergetrennt. Bewegen können wir uns nur zusammen.
*

Für mich ist Feminismus kein Schimpfwort, vielmehr sollte Gleichberechtigung selbstverständlich sein. Jeder sollte so leben können, wie er möchte und wie es für ihn stimmt. Aber ob das Feminismus ist oder einfach normal sein sollte? Es braucht diese Bewegung nach wie vor, auch wenn man sieht, dass sich etwas verändert.
In erster Linie finde ich es in allen Formen des Zusammenlebens wichtig, dass jeder machen kann, was er als richtig empfindet, und Wertschätzung erhalt für das, was er tut. Ich bin seit 20 Jahren Bäuerin. Heute lebe ich nicht mehr als Lebenspartnerin auf dem Hof, meiner Arbeit dort gehe ich aber nach wie vor mit Freude und Motivation nach. Ich habe schon das Gefühl, dass sich die Rolle der Frauen auf Höfen verändert hat und sie den Mut haben, ihren Weg trotz bestehender gesellschaftlicher Bilder, wie eine Bäuerin zu sein hat, weiterzugehen. Ich finde es sehr wichtig, dass Frauen sich trauen, für sich einzustehen und sich nicht von klischeebehafteten Bildern leiten oder unter Druck setzen zu lassen.
Gerade wurde die soziale Absicherung der Partnerin oder des Partners auf landwirtschaftlichen Betrieben zum ersten Mal in der Agrarpolitik verankert: Der Landwirt ist verpflichtet, seine Frau zu versichern, sonst hat dies Auswirkungen auf die Direktzahlungen. Ein wichtiger Entscheid, denn es ist noch nicht auf allen Betrieben so, dass die Partnerin entweder Teilhaberin oder Angestellte ist, weil es oft schlicht vergessen geht, dies festzulegen. Trotzdem wäre es auf vielen Betrieben ein Riesenproblem, wenn die Frau zum Beispiel unfallbedingt ausfallen würde und kein Taggeld bezogen werden könnte.
So viel zum Feminismus: Es ist nicht allein an den Männern, für die Frauen und ihre Rechte einzustehen, sondern Frauen müssen den Mut haben, Forderungen zu stellen. Es profitieren schliesslich alle davon. Und diese Rechte wären für alle Frauen wichtig, gerade für solche, die sich entscheiden, Hausfrau zu sein und nicht extern zu arbeiten. Aber dort ist es nicht sichtbar, nicht steuerbar. In meiner Verbandstätigkeit bleiben wir beharrlich dran für alle Frauen vom Land, sind offen für andere Meinungen und machen uns stark für pragmatische, tragfähige Lösungen.
*
Sind Sie heute eine andere Frau,
Sümeyra Eliçabuk?
In meiner Heimat, der Türkei, habe ich viel gearbeitet. Ich bin Ärztin – das ist meine Berufung. Ich habe viel in diese Karriere hineingegeben. Manchmal kam ich nur kurz nach Hause, um die Kinder ins Bett zu bringen, bevor ich nochmals ins Spital gefahren bin.
Seit dreieinhalb Jahren lebe ich in der Schweiz. Ich bin immer noch Ärztin, spezialisiert auf Pathologie. Aber ich bin nicht mehr nur das. Es haften neue Vorurteile an mir: Ich bin eine Frau. Ich bin Mutter. Ich bin Muslima. Ich trage Kopftuch. Und ich möchte Teilzeit arbeiten, idealerweise 70 Prozent. All das macht es doppelt und dreifach schwer.
Schon mein Mann – auch er ist Arzt – ist bei der Stellensuche auf Ablehnung gestossen, einfach weil er Türke ist. Doch bei ihm war es nicht dasselbe. Auch er hat drei Kinder, aber das scheint bei ihm kein Problem zu sein. Die Leute denken nur an mich.
Es wirkt fast so, als wollte die Politik, dass Frauen nicht arbeiten. Frauen mit Kindern müssen entweder zuhause bleiben und den Beruf aufgeben oder eine Kita oder Tagesmutter finden. All diese Optionen sind finanziell schwierig. Ein kleines Arbeitspensum lohnt sich also kaum – aber arbeite ich viel, heisst es, ich vernachlässige meine Kinder.
Ich könnte auch arbeiten, ohne Kopftuch zu tragen. Aber ich komme gar nicht so weit, das zu zeigen. Kürzlich habe ich mich auf eine Stelle als Pathologin beworben und alle Unterlagen eingereicht. Man stellte mir einen Vertrag in Aussicht, es fehlte nur noch die Kopie meines Passes. Nachdem ich diese verschickt hatte, hörte ich nichts mehr. Später kam ein Anruf: Die Stelle sei nur für Studierende. Der Arbeitgeber hat erst auf dem Pass ein Foto von mir gesehen – darauf trage ich Kopftuch. Das scheint zu irritieren.
In der Türkei sind Bewerbungsverfahren anonym. Es gibt keine Vorstellungsgespräche wie hier. Geschlecht oder Aussehen spielen also keine Rolle. Auch beim Lohn gibt es dadurch weniger Diskriminierung.
Oft höre ich auch: «Du sprichst sehr gut Deutsch!» Die Menschen sind überrascht, selbst in Bewerbungsgesprächen. Und dennoch heisst es am Ende, mein Deutsch sei nicht gut genug.
Was wir brauchen, ist Inspiration. Auch auf dem Arbeitsmarkt. Vorbilderinnen, sozusagen.
Sümeyra Eliçabuk ist aus der Türkei geflüchtet. Da sie aktuell auf Stellensuche ist, möchte sie ohne Foto sprechen.
*
Texte aufgezeichnet von Andrina Gerner, Fabienne Niederer und Sharon Saameli